Zwischen den Zeilen
Zwischen den Zeiten
Leipziger Buchmesse 2023
27.-30. April | Literatur aus Südosteuropa
#lbm23 #traduki #zeilenzeiten
Die Leipziger Buchmesse 2023 findet vom 27. bis 30. April 2023 statt.
Dazu wird es von TRADUKI spannende Begegnungen mit Autor:innen und Balkankenner:innen geben: auf der Leipziger Buchmesse, im UT Connewitz und in der Suedbrause – bei Freunden. Unverändert findet die schon traditionelle Balkan Film Week in den Wochen vor der Buchmesse statt.
Programm
-
Donnerstag, 27. April 2023
-
Save the date!
-
TRADUKI verbindet durch Bücher, Übersetzungen, Residenzprogramme und zahlreiche andere Literaturprojekte den Südosten Europas mit dem deutschsprachigen Raum und auch die südosteuropäischen Nachbarn untereinander. In den vergangenen Jahren hat sich ein intensiver und vielfältiger Austausch entwickelt: zwischen den Sprachen und Literaturen, den Leser*innen und Verleger*innen, zwischen den Literaturszenen in vierzehn europäischen Ländern.
Die Außenministerien in Berlin und Wien gehören zu den Mitbegründern dieses öffentlich-privaten Unterfangens.
Ralf Beste und Christoph Thun-Hohenstein, Vertreter des Auswärtigen Amtes und des Österreichischen Außenministeriums, die in ihren Häusern die jeweilige auswärtige Kulturpolitik gestalten, diskutieren mit der Autorin Ana Marwan und der Belgrader Übersetzerin und Verlegerin Bojana Denić wie die kulturpolitische Zusammenarbeit weiterentwickelt werden kann.
Mitveranstalter: Gastland Österreich Leipziger Buchmesse 2023, Auswärtiges Amt und BMEIA
-
Die junge künstlerische Form «Filmisches Poem» zwischen Literatur und Film wird mit Beispielen gezeigt und bei einer Podiumsdiskussion besprochen.
Eine Kooperation der Kulturstiftung Liechtenstein mit TRADUKI und dem Gastland Österreich Leipziger Buchmesse 2023.
-
Ein Gespräch mit vier jungen albanischen Schriftsteller:innen: Flogerta Krypi, Loer Kume, Ervin Nezha und Andreas Dushi. Alle vier haben in den letzten Jahren wichtige Literaturpreise in Albanien gewonnen.
-
Wie sieht die europäische Literaturlandschaft in Übersetzung aus und wer fehlt auf dieser Landkarte? Die sogenannten „kleinen“ Sprachen sind in den größeren Sprachräumen noch immer wenig präsent und ihre Perspektiven oft genug eine Leerstelle in der Vielfalt Europas. Nach einer Bestandsaufnahme der Ist-Situation soll die Frage stehen, was getan werden kann, damit kleinere Sprachen und ihre Literaturen noch mehr in den Fokus kommen, nicht zuletzt zur Bereicherung des deutschsprachigen Buchmarkts.
Veranstalter: IG Übersetzerinnen / Übersetzer
Mitveranstalter: TRADUKI -
Die Lyrik hat einen besonderen Stellenwert in der slowenischen Literatur. Drei renommierte slowenischen LyrikerInnen Miljana Cunta, Cvetka Lipuš und Uroš Prah werden ihre neuen deutschen Übersetzungen im Gespräch mit Erwin Köstler vorstellen: Weggehen für Anfänger (Otto Müller Verlag, 2023, übersetzt von Klaus Detlef Olof), Tagesgedichte (Edition Thanhäuser, 2022, übersetzt von Matthias Göritz und Amalija Maček) und Erdfall (Luftschacht Verlag, 2023, übersetzt von Daniela Kocmut).
Veranstalter: Slowenische Buchagentur JAK
Mitveranstalter: TRADUKI -
Der Erzählband „Notizbuch der Liebe“ des jungen kosovarischen Autors Shpëtim Selmani erschien 2021 beim Verlag Parasitenpresse (aus dem albanischen von Zuzana Finger). In seinen Prosastücken schreibt Selmani über Alltägliches, über Begegnugen und Beziehungen; er reflektiert aber auch die Literatur und das Weltgeschehen, den Nationalismus, den Materialismus und andere -ismen. Vor allem schreibt er aber über – die große Liebe.
Für das Werk wurde Selmani 2020 mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet.
Veranstalter: Nationalbibliothek Kosovo
Mitveranstalter: TRADUKI -
Er dient der UdSSR mit mehr Inbrunst als die sowjetischen Führer selbst, sagte der Schriftsteller Georgi Markow über Todor Schiwkow, von 1954-1989 Staatschef Bulgariens. Serbien wiederum, damals Teil Jugoslawiens, brach schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Sowjetunion. Moldau erklärte 1991 seine Unabhängigkeit. Aber: Wie sehen heute die Beziehungen dieser drei Länder zu Russland aus? So unterschiedlich sie sind, ist ihnen aktuell gemeinsam, dass sie kulturell, politisch und wirtschaftlich in besonderem Maße russischem Einfluss unterliegen. In allen drei Ländern definieren sich prorussische Kräfte dezidiert antieuropäisch. Was heißt dies für die jeweiligen Länder und wie gehen europäisch orientierte Kräfte damit um?
Das Gespräch wird in englischer Sprache geführt.
Mitveranstalter: Debates on Europe, Rumänisches Ministerium für Kultur
-
-
Freitag, 28. April 2023
-
Der zweite Roman der slowenisch-österreichischen Ingeborg Bachmannpreisträgerin Ana Marwan ist ein Fest für Literatur- und Sprachspielliebhaber. „Verpuppt“ (Otto Müller Verlag, Ü: Klaus Detlef Olof) erzählt die Geschichte von Rita und Jež (Igel), die heimliche Hauptfigur des Buchs aber ist die Sprache selbst: „Verpuppt“ entpuppt sich als ein Buch über das Geschichtenerzählen und die Frage, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Wirklichkeit sprechen? Das Buch ist ein großes Spiel mit kleinen (und großen) Wörtern, ihrer Struktur, ihrer Bedeutung und ihrem Klang.
Mitveranstalter: Gastland Österreich Leipziger Buchmesse 2023
-
Albanien ist seit 2014 offiziell EU-Beitrittskandidat, im Juli 2022 wurden die Beitrittsverhandlungen eröffnet. Nearly there? Die in Deutschland lebende albanische Autorin und Journalistin Lindita Arapi („Albanische Schwestern“, Ü: Florian Kienzle) spricht mit Vedran Džihić, Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik und Lektor an der Universität Wien, über Albanien und dessen Platz in Europa. Welche Lebensentwürfe gibt es im ‚Wartesaal Europas‘? Und welchen Versprechungen soll und darf man Glauben schenken?
-
Eine Kooperationsveranstaltung von ‚meaoiswiamia‘ und TRADUKI und dem ‚Jahr der österreichischen Literatur‘ des BMEIA. Das Übersetzen sei zu Ihrer ‚Hauptsprache‘ geworden, schreibt die Autorin und Übersetzerin Mascha Dabic in ihrem Text ‚Zähne zusammenbeißen‘. Mascha Dabic, die in Wien lebt und in Sarajevo geboren wurde, zählt zu den herausragendsten Protagonistinnen Ihres Fachs in Österreich: sie übersetzt aus dem Serbischen, dem Bosnischen, dem Kroatischen, Englischen wie Russischen. Welcher Stellenwert kommt dem Übersetzen in Österreich zu? Und für welche Sprachen ist Österreich ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt? Dass etwa Dzevad Karahasan oder Drago Jancar über Österreich zum deutschsprachigen Publikum fanden, ist kein Zufall, sondern liegt nicht zuletzt an der geographischen Lage des Landes, seiner Geschichte wie an dem Umstand, dass Österreich selbst ein mehrsprachiges Land ist: es gibt allein 6 autochthone Volksgruppen: die slowenische, die burgenlandkroatische, die tschechische, slowakische, die Volksgruppe der Roma und Sinti und die ungarische. Nachdem ein Gastlandauftritt bei der Buchmesse auch immer der Versucht einer Übersetzung ist, soll auch diese Veranstaltung dazu beitragen, die Vielgestaltigkeit des Landes Österreich sichtbar zu machen.
Eine Kooperation von Gastland Österreich Leipziger Buchmesse 2023, IG Autorinnen Autoren, TRADUKI und dem BMEIA
-
Der Zusammenbruch Jugoslawiens bedeutete auch einen Zerfall vieler Einzelbiographien, die nun nicht mehr linear verliefen, sondern jede für sich zum Mosaik immer neu zusammengesetzter Bruchstücke wurden. Eine dieser Lebensgeschichten erzählt auch dieses Buch, dessen Titel unweigerlich das Bild einer mächtigen Einzelkämpferin aufruft. Nostalgisch, aber ohne den Zuckerguss unnötiger Übertreibung nimmt uns Olja Knežević mit aus dem früheren Titograd nach Belgrad, weiter nach London und schließlich zurück ins heutige Podgorica; mit Sex, Drogen und Krieg als Hintergrundmusik. Die Frauen im Leben der Protagonistin erkranken, altern und sterben, doch genau sie geben ihr Kraft und sind ihr Vorbild, wogegen die Männer als Randfiguren die Energie meist nur absaugen.
Veranstalter: eta Verlag
Mitveranstalter: TRADUKI -
In der Veranstaltung wird thematisiert, wie Krieg Graphic Novels prägt oder auch Alltagsgeschichten von Liebe und Beziehung plötzlich in einem veränderten Kontext dastehen. Die slowenische Künstlerin Samira Kentrić und Liechtensteiner Comiczeichner und Illustrator Meikel Mathias im Gesrpräch mit Verlegerin und Autorin Anne König und Samira Kentrićs Übersetzerin Barbara Anderlič.
Eine Kooperation der Kulturstiftung Liechtenstein mit TRADUKI und dem Gastland Österreich Leipziger Buchmesse 2023.
-
Die Einstellung (Suhrkamp, 2022) ist der aktuelle Roman des österreichischen Autors Doron Rabinovici.
Mit Witz, Ironie und Fabulierlust erzählt Doron Rabinovici in seinem neuen Roman von einer immer stärker polarisierten Gegenwart, einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft. Es geht um die Relativierung von Fakten, die Anziehungskraft des Autoritären, die Macht der Bilder. Es geht um den Kampf eines Populisten gegen einen Fotografen, der genau weiß, dass jede Aufnahme Zeugnis einer Einstellung ist.
Veranstalter: TRADUKI
-
In Georgi Gospodinovs Roman trifft der Erzähler auf Gaustine, einen Flaneur, der durch die Zeit reist. In Zürich eröffnet Gaustine eine »Klinik für die Vergangenheit«, eine Einrichtung, die Alzheimer-Kranken eine ganz besondere Behandlung anbietet: Jedes Stockwerk ist einem bestimmten Jahrzehnt nachempfunden. Patienten können dort Trost finden in ihren verblassenden Erinnerungen. Aber auf einmal interessieren sich auch immer mehr gesunde Menschen dafür, in die Klinik aufgenommen zu werden, in der Hoffnung, dem Schrecken der Gegenwart zu entkommen. Und schließlich sind es sogar ganze Länder, die Gaustines Idee von den Vergangenheitsräumen folgen, und in frühere Zeiten zurückkehren wollen.
Der Roman Zeitzuflucht erschien 2022 beim Aufbau Verlag. Aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann.
Veranstalter: TRADUKI
Mitveranstalter: Kulturministerium der Republik Bulgarien -
Eines der überraschenden Merkmale der letzten hundert Jahre ist, wie oft Philosophen auf Beispiele aus der Popkultur zurückgreifen (Kriminalromane, populäre Filme und Fernsehserien von Hitchcock bis Matrix, von Wire bis Mad Men, von Videospielen bis Facebook), um Einsichten zu grundlegenden Fragen wie der Freiheit in der heutigen Zeit, dem Status der Realität, der sozialen Kontrolle und der Veränderung des öffentlichen Raums zu formulieren. Es stellt sich die Frage, ob diese Bezugnahme auf die Populärkultur wirklich nur ein Mittel ist, um Einsichten zu popularisieren? Was, wenn sie die Tatsache zum Ausdruck bringt, dass die heutige Populärkultur subtile Veränderungen registriert, die sich der Hochkultur und den üblichen Gesellschaftsanalysen entziehen? Das Gespräch findet auf Englisch ohne Verdolmetschung statt.
Eine Kooperation von TRADUKI mit der Slowenischen Buchagentur JAK
-
Eine Veranstaltung mit dem als heimlichen Nobelpreisträger gehandelten rumänischen Autor Mircea Cărtărescu. In seinem neuen Erzählband „Melancolia“ (Ü: Ernest Wichner) geht es dem Autor um existenzielle Einsamkeit. Kinder und Jugendliche sind seine Protagonisten, sie dringen vor auf unbekanntes, furchterregendes und zugleich faszinierendes Terrain. Virtuos operiert der Autor mit modernen und postmodernen Erzählweisen, mit Elementen der Genreliteratur von Horror bis Science-Fiction, von religiöser Erbauungsliteratur bis Schmetterlingskunde.
Mitveranstalter: Ministerium für Kultur Rumäniens
-
Lana Bastašić und Faruk Šehić unterhalten sich über ihre neuen Bücher: „Mann im Mond“ von Bastašić (Ü: Rebekka Zeinzinger) und „Uhrwerksgeschichten“ von Šehić (Ü: Elvira Veselinović). Außerdem reflektieren sie die postjugoslawische literarische Szene und ihr ‘neues Leben’ in Berlin als DAAD-Stipendiaten. Das Gespräch findet auf Englisch ohne Verdolmetschung statt, die Textpassagen werden auf Deutsch gelesen.
Mitveranstalter: S. Fischer Verlag
-
-
Samstag, 29. April 2023
-
Am 20. Januar 2022 jährte sich zum 80. Mal die berüchtigte Wannseekonferenz mit ihrem fatalen Beschluss zur „Endlösung der Judenfrage“. Auf dem Balkan wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als achtzig Prozent der jüdischen Bevölkerung umgebracht. Die Zeugen, die vom Schrecken dieser Zeit berichten könnten, werden immer weniger. So ist es denn die Literatur, die an das Schicksal erinnert. Im postjugoslawischen, ja im ganzen südosteuropäischen Literaturraum sind bedeutende und bewegende Texte dazu geschrieben worden, u.a. von David Albahari, Đorđe Lebović und Judita Šalgo. Im Gespräch, moderiert vom israelisch-österreichischen Autor und Historiker Doron Rabinovici, stellt der Autor und Kenner der jüdischen Kultur, Marko Dinić, die Werke vor und Dr. Martina Bitunjac (Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien) erläutert und reflektiert den historischen Hintergrund.
-
Ioana Nicolaie schreibt Gedichte und Prosa. Ihre Werke erscheinen in deutscher Übersetzung im Pop Verlag. Nadya Radulova ist Dichterin; der zweisprachige Gedichtband „Kleine Welt, große Welt“ ist ihr erstes Werk in deutscher Übersetzung und erscheint im März 2023 beim eta Verlag.
Veranstalter: eta Verlag, Kulturministerium Rumänien
Mitveranstalter: TRADUKI -
Auf sehr poetische Weise erzählt Tatjana Gromača vom Zerbrechen ihrer Mutter in der Zeit der Wirtschaftskrise, des wütenden Nationalismus und des Krieges im Kroatien der 90er Jahre. Sie verknüpft die Diagnose des Zustands ihrer Mutter bzw. ihrer Eltern mit einer bisweilen drastischen und ironisch-witzigen Beschreibung der durch den Bürgerkrieg zerstörten „kranken“ Gesellschaft. Tatjana Gromača erhielt für ihren Roman den „Vladimir Nazor Preis für Literatur“ und den „Jutarnji Preis als Roman des Jahres 2013“ in Kroatien.
Mit der Autorin spricht Will Firth, der den Erzählband Die Göttlichen Kindchen ins Deutsche und Englische übersetzt hat. Die deutsche Ausgabe erschien 2022 bei Stroux Edition.
Mitveranstalter: Kulturministerium der Republik Kroatien, Stroux Edition
-
Poesie ist Freiheit. Poesie ist Rebellion. Und Freiheit und Rebellion sind das, was der slowenische Punk zu etwas Einzigartigem verbunden hat. Anlässlich der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung der Anthologie (Verlag Heyn, 2023) werden der slowenische Dichter und Herausgeber, Esad Babačić, und der kroatische Dichter Marko Pogačar über slowenische Punk-Poesie sprechen. Die Diskussion wird von Miha Kovač moderiert.
Veranstalter: Slowenische Buchagentur JAK
Mitveranstalter: Kulturministerium der Republik Kroatien, SKICA BERLIN, TRADUKI -
Ag Apolloni (1982) ist ein bekannter Name in der kosovarischen Literatur. Er schreibt Romane, Gedichte, Essays und Theaterstücke. Sein aktueller Roman mit dem Titel Kësulëkuqja (përrallë për të rritur) – auf deutsch „Rotkäppchen. Ein Märchen für Erwachsene“ – erschien 2022. Der Roman, auf der Oberfläche eine Liebesgeschichte zwischen Lorita, der Schauspielerin, und Max, dem Autor, handelt von Krieg, Gewalt und Kriegstraumata.
Veranstalter: Nationalbibliothek Kosovo
Mitveranstalter: TRADUKI -
Im Kurzfilmprogramm PRESTO bekommt das Publikum einen Einblick in die unterschiedlichsten ästhetischen Positionen österreichischer Filmpoeme: Verfilmte Texte stehen hier neben selten gezeigten Video Poems, also mit filmischen Mitteln erzeugte Kunstwerke. Am dritten und abschließenden Abend sind Andrea Grill und Barbara Anderlič zu Gast und sprechen über Möglichkeiten medialer Transformation.
Eine Kooperation der Kulturstiftung Liechtenstein mit TRADUKI und dem Gastland Österreich Leipziger Buchmesse 2023.
-
The one and only BALKANNACHT. Auch diesmal präsentiert TRADUKI eine spannende Mischung literarischer Stimmen aus dem Südosten Europas – zusammen mit der rockig-folkig-poetischen Musik von Jelena Popržan.
Mitveranstalter: Ministerium für Kultur Rumäniens, Voland & Quist
-
-
Sonntag, 30. April 2023
-
Im Garten des Café Suedbrause veranstaltet TRADUKI heuer eine veritable “Lyrikbrause” mit Leckerbissen auf dem Tisch und lyrischen Köstlichkeiten aus Deutschland/Kosovo, Kroatien und Montenegro auf der Bühne.
-
Die Erfahrung verschlossener Tore teilen viele Menschen aus dem früheren Ostblock. Arian Leka, an der Adria geboren und aufgewachsen, erinnert sich an seine Kindheit und Jugend hinter verriegelten Grenzen und geht beharrlich der Frage nach, wie das einst freie Meer zu einer verbotenen Zone wurde. Dazu konfrontiert er seine Erfahrungen mit albanischen Legenden und der albanischen Geschichte. Auslöser für die Arbeit an den Texten in diesem Buch waren die zahlreichen Toten bei der Flucht über das Meer in Richtung Italien, als sich nach dem Sturz des Regimes von Enver Hoxha zwar für die Bürger Albaniens die Tore in Richtung Europa öffneten, aber Europa sich gegen die Flüchtlinge abschottete. Für Arian Leka sind Einsperrung und Aussperrung gleichermaßen unerträglich und seine Empathie gilt längst nicht mehr allein den albanischen Opfern, sondern allen bei der Flucht über das Mittelmeer Ertrunkenen. Zugleich geht er mit der jüngeren Vergangenheit seines Landes ins Gericht, die durch die späte (verspätete) Aufarbeitung der Verbrechen des Regimes von Enver Hoxha bis heute eine Bürde für Albanien darstellt.
Veranstalter: TRADUKI
Mitveranstalter: Goethe Zentrum Tirana
-
Zwischen den Zeilen
Zwischen den Zeiten
Auftritt TRADUKI – Bühne frei für Südosteuropa! In nahezu 20 Veranstaltungen präsentiert TRADUKI zur diesjährigen Leipziger Buchmesse Autor:innen aus Südosteuropa auf der Messe im traditionsreichen „Café Europa“ und erstmalig in der TRADUKI-Kafana. Unter dem programmatischen Titel „Zwischen den Zeilen – Zwischen den Zeiten“ widmet sich unser Programm den verborgenen Seiten und Momenten des Lebens, der Mehrdeutigkeit von Erfahrungen, Sichtweisen und der Vielfalt von Lebenswelten. Dabei sind der genaue Blick und der intensive Dialog unabdingbar. Die Autor:innen und ihre moderierenden Gastgeber:innen widmen sich den Brüchen, Sprüngen und Kehrtwendungen in den Lebenslinien von Menschen und Ländern. Das heißt auch, dass Kindheitserinnerungen neu interpretiert werden und damit bisweilen für die Vergangenheit Platz in der persönlichen und politischen Zukunft geschaffen werden muss. Das Leipziger TRADUKI-Programm 2023 will die Räume „dazwischen“ besser sichtbar und erfahrbar machen, denn gerade hier spielt sich oft Entscheidendes ab.
Mitwirkende
Auszüge
Der berühmte jugoslawisch-jüdische Schriftsteller Danilo Kiš erinnerte sich in einem Interview daran, wie seine Mutter für ihn und seinen Vater den für Juden vorgeschriebenen gelben Davidstern anfertigte. Dabei erklärte er auch, warum er diese Szene nie in eines seiner Werke einfließen ließ. Und in der Tat, wie kann man über etwas so Schreckliches schreiben?
Über das wenig bekannte Thema des Holocaust in der Literatur des postjugoslawischen Raums werden wir am 29. April um 12 Uhr auf der Leipziger Buchmesse sprechen, nämlich bei der Veranstaltung „Die Wagen brauchen sie für andere Dinge“ im Café Europa.
Zwei Beispiele dafür, wie der Holocaust in der Literatur dieser Region behandelt wird, sind Semper idem von Đorđe Lebović und Put u Birobidžan von Judita Šalgo, die wir hier in Auszügen zum ersten Mal in deutscher Übersetzung präsentieren.
Leipziger Buchmesse 2020-2022
Überblick über das komplette TRADUKI-Programm auf der Leipziger Buchmesse 2022, 2021 und 2020:
Semper idem
Übersetzt von Jelena Dabić
-
Ich notierte in mein Allerlei-Notizheft: „15. Juli 1938. Ein wichtiges Datum: ab heute bin ich kein Millionär mehr.“ An diesem Tag tauchten wieder die G-men auf. Diesmal fehlte Charly Chen. Sie kamen herein, größten den Stiefvater, setzten sich, der Birnenkopf sagte: „Ich würde Sie bitten, das Radio leiser zu stellen“, und Stiefvater erwiderte: „Das ist nicht das Radio, sondern meine Frau, im Nebenzimmer, sie hält eine Klavierstunde.“ Der Birnenkopf sagte darauf: „So ist es, ich entschuldige mich. Ich habe es vergessen.“ Nach all dem erklärte Herr Bilak und Bilak feierlich: „Ihr Onkel, Jakov Buchwald, ist ein gewöhnlicher Betrüger.“ Der Stiefvater meinte: „Wirklich?“ Sonst nichts. Bilak und Bilak fuhr fort:
„Er hat seine Geschäfte illegal geführt. Er hat Steuern hinterzogen und seine Gewinne nicht wahrheitsgetreu deklariert. Sein Reichtum ist bloß ein Trugbild, eine Zahl auf dem Papier. In Wahrheit schuldete er schon die Haare auf seinem Kopf.“
Genau so sagte er es: „Er schuldet selbst die Haare auf seinem Kopf.“ Dieser Vergleich gefiel mir, obwohl sich dann die Frage stellte: Was, wenn Onkel Jakov eine Glatze hatte?
Zu Wort meldete sich nun Herr Gavran, eher bekannt als der Glotzäugige, um in allen Einzelheiten zu erklären, wie und warum Jakov Buchwald „selbst die Haare auf seinem Kopf schuldete“. Ich hatte überhaupt nichts verstanden. Er sprach rätselhafte Worte aus, wie Wahrsagerinnen in ihren Wahrsagungen. Anteil, Rente, Bilanz, Obligation, Dividende, Tantieme, Hypothek. Ich war mir sicher, dass der Sinn dieser Worte ebenso wenig das Bewusstsein meines Stiefvaters erreichte, der Sinn von Worten, von denen jedem vernünftigen Menschen schwindling werden musste. Nach ausführlicher Darlegung durch seinen Gehilfen, zog der Birnenkopf den Schluss: „Nach Begleichung der Steuern, Schulden und Zinsen wird das gesamte übrige Vermögen auf etwa 15.000 Dollar geschätzt. Ich schlage vor, dass Sie den ganzen Betrag für wohltätige Zwecke verwenden, denn wenn Sie ihn auf die Hand erhalten möchten, müssen Sie ein Hinterlassenschaftsverfahren einleiten, und dieses wir sie doppelt so viel kosten.“
„Ich verschenke es“, sagte Stiefvater großzügig. Er schien mir in diesem Moment erleichtert, als hätte er sich von einer schweren Last befreit (Oma Laura würde sagen: „ihm ist ein Stein vom Herzen gefallen“). „Zum Glück schulden Sie der Anwaltskanzlei ‚Bilak und Bilak‘ nichts“, klärte uns der Glotzäugige auf. „Alle unsere Kosten wird das amerikanische Konsulat begleichen.“
Diesmal fiel dem Stiefvater ein, den Besuchern Schnaps und Kaffee anzubieten. Sie lehnten ab, verbeugten sich und gingen wieder. Ganz zu unserer Zufriedenheit.
Der Stiefvater war viel ruhiger und gefasster als vor einem Monat, als man ihm mitgeteilt hatte, dass er Millionär geworden sei. Er sagte zu mir: „Was habe ich dir gesagt? Ein Schuft bleibt immer ein Schuft.“ Die Mutter sagte in der Pause zwischen zwei Stunden: „Was für ein Gauner! Er wollte dir seine Schulden schenken.“ Der Stiefvater ließ sich nicht ärgern: „Er hatte immer einen Sinn für Humor“, bemerkte er gutmütig. „Sein Humor ist giftig“, erklärte Mutter. „Bist du sehr enttäuscht?“, fragte der Stiefvater besorgt, und die Mutter antwortete: „Nein, überhaupt nicht, ich habe ja auch nichts erwartet. In meinem Leben sind keine Millionen und keine Reisen in die weite Welt vorgesehen. Ich kann mein Schicksal nicht überlisten.“ Auch ich regte mich nicht sehr auf. Ich dachte mir: was verliere ich schon? Ein Fahrrad? Ich habe bisher auch keines gehabt, und es hat mir nicht gefehlt.
Der Stiefvater atmete auf, die Mutter fand sich mit ihrem Schicksal ab, und ich zog den Schluss, dass es Hauptsache war, dass wir am Leben geblieben waren. So dachten wir. Oma Laura sagte oft: „Der Mensch denkt, Gott lenkt.“ Wir hatten von Millionen geträumt, von Fahrrädern, über die USA. Gott hatte entschieden, dass sich unsere Träume nicht erfüllten. Das war genug von ihm, dennoch hatte er noch nicht genug. Er beschloss, uns zu bestrafen. Ich fragte mich: Warum? Die ältere Schwester der Stiefmutter, meine Reserve-Tante, Teri Ujkeri, würde wahrscheinlich darauf sagen: „Nur Er kennt die Antwort“. Er hat nichts darauf gesagt. Oder er hatte meine Frage nicht gehört oder, vielleicht, wusste selbst Er keine Antwort.
Onkel Stevan pflegte zu sagen, ein Unglück komme niemals allein, sondern immer gemeinsam mit einer Menge Dummköpfe. Die Dummköpfe, die über uns hergefallen waren, solange der Stiefvater Millionär war, stürmten wieder heran. Zuerst wurde in einem Abendblatt die Nachricht veröffentlicht, dass das Millionenerbe des Nichtstuers Andrija Buchwald eine ausgemachte Erfindung sei. Den Artikel schmückte die Überschrift: NEUE UNVERSCHÄMTE JÜDISCHE LÜGE UND BETRUG. Alles, was in diesem Artikel stand, entsprach nicht der Wahrheit, es stimmte nur, dass der Stiefvater Jude war, und das er ohne feste Anstellung war. Die am häufigsten verwendeten Ausdrücke waren: Lüge, Schwindel, Betrug. Davor mit dem obligatorischen Kennzeichen: jüdisch. Im Großen und Ganzen lief das Ganze darauf hinaus, dass der jüdische Hochstapler von leichtgläubigen und arglosen Mitbürgern Unmengen an Geld geliehen hatte, teils als Darlehen, teils als Einsatz in ein Geschäft. Zum Schluss drückte der nicht namentlich genannte Verfasser des Artikels die feste Überzeugung aus, dass der Urheber dieser unehrenhaften Handlungen angemessen bestraft werde.
Schon am nächsten Morgen erschien auf der Fassade unseres Wohnhauses ein großer Davidstern, mit roter Kreide aufgemalt. Darunter stand: ALLE JUDEN SIND LÜGNER UND GAUNER. Später, im Laufe des Tages, tauchte auf unserem Eingangstor eine Schrift in Fettfarbe auf: JUDEN RAUS AUS KROATIEN. Dem Stiefvater begegneten wieder Unbekannte auf der Straße, die ihm Beleidigungen und Drohungen entgegenschmetterten. Der Besitzer des Lebensmittelgeschäfts bat ihn, nicht mehr bei ihm einzukaufen, „ich bitte Sie sehr“, weil er ihm die Kunden vertreibe, „nicht wahr“. Das Gleiche wurde ihm in der Bäckerei gesagt. Nur der Metzger, ein Serbe aus Šimanovci, war anderer Meinung: „Sie haben Ihnen etwas unterstellt, die Schufte“, ärgerte er sich und hackte dabei mit einem Hackbeil, mit voller Kraft, eine Rindsschulter abhackte. „Die können auch nichts anderes, als herumzustochern und unschuldige Menschen zu zermahlen.“
Am nächsten Tag besuchte uns der Hausbesitzer. Er bat die Mutter (sehr höflich), bis spätestens Ende Juli aus der Wohnung auszuziehen. „Ich persönlich habe nichts gegen Sie“, näselte er, als wäre er erkältet, „aber die Hausbewohner beschweren sich, wissen Sie. Ihretwegen sind ständig Leute im Haus, und an den Wänden stehen irgendwelche hässlichen Hinweise.“
Die Mutter behielt trotz allem die Fassung, bis sie ins Sekretariat der Jüdischen Religionsgemeinde eingeladen wurde. Dort wurde ihr wohlmeinend nahegelegt, dass es sehr klug wäre, wenn sie gemeinsam mit ihrer Familie Zagreb verlassen würde, da unsere Anwesenheit der jüdischen Minderheit, die ohnehin in einer schwierigen Lage sei, sehr schaden würde. Die Mutter war in Zorn entbrannt. Sie sprach laut, mir schien, sie war gewachsen und ihre Arme länger geworden: „Anstatt uns zu verteidigen, vertreibt ihr uns! Das wird euch nicht vor diesem Pöbel retten. Im Gegenteil!“ Alle im Büro schwiegen und sahen zu Boden. Das war alles, was sie für uns getan haben.
Noch am selben Abend sagte die Mutter: „Wir gehen weg von hier.“ Der Stiefvater fragte: „Wohin?“
„Wir fahren sicher nicht nach Connectic-tac“, antwortete die Mutter. Sie sagte auch Connectic-tac, also war sie nicht allzu schlecht gelaunt. „Fahren wir nach Sombor?“, fragte ich, in Erwartung einer Bejahung. Ich freute mich schon auf ein Wiedersehen mit dem Vater, mit Onkel Stevan und meinem Freund Kapi. „Nein. Wir fahren nach Subotica“, sagte die Mutter.
Ich war noch nie in Subotica gewesen, der Heimatstadt meiner Mutter. Ich sah sie an, ihren gesenkten Kopf, ihre fest zu Fäusten geballten Hände und war sicher, dass sie nicht in diese Stadt zurückkehren wollte, weil sie schöne Erinnerungen mit ihr verbanden, und der Stiefvater dachte offensichtlich das Gleiche. „Meinetwegen müssen wir nicht nach Subotica. Ich habe es auch hier gut“, sagte er. „In Zagreb können wir nicht bleiben, in Subotica ist Tante Flora. Sie wird eine Wohnung für uns finden, und ich bin sicher, dass ich auch eine Stelle in der Musikschule finde.“ Der Stiefvater stimmte ohne Widerstand, wenn auch unwillig, zu. Er kümmerte sich nicht sehr um seine Arbeitsstelle.
Ein Polizist in Uniform war gekommen und brachte einen Brief. Darin bat ein gewisser Ermittler Herrn Buchwald höflich, ihn in seiner Polizeizweigstelle zu besuchen, auf Zimmer so und so, am selben Tag zu Mittag, wegen eines kurzen Gesprächs. Der Stiefvater ging hin. Zum Mittagessen kam er nicht, und auch nicht zum Abendessen. Als ich zu Bett ging, war der Stiefvater noch nicht zurück. Die Mutter hatte die ganze Nacht durchwacht. Am Morgen zog sie ihr graues Kostüm, das sie nur bei feierlichen Anlässen trug. Es war nicht mehr neu, dennoch sah sie darin vornehm aus, sie war noch immer schlank und anziehend, wenigstens glaube ich das. Von Tante Paulina habe ich später erfahren, dass sie zum Richter am Berufungsgericht gegangen war, der lange Zeit Mieter in der Pension am Lang-Platz gewesen war. „Retten Sie meinen Mann“, soll sie gesagt haben, „er ist unschuldig, er hat keinem etwas zuleide getan“. Und sie hat noch gesagt: „Als Gegenleistung kann ich Ihnen nichts anbieten. Ich kann Sie nur zum Mittagessen einladen.“ Der Richter, an dessen Namen und Aussehen ich mich nicht erinnern kann, ist nicht zu uns zum Mittagessen gekommen, aber der Stiefvater kam am nächsten Morgen nach Hause zurück. Er sah elend aus. Zerknittert, das linke Auge geschwollen, er konnte bloß unter den geschwollenen Lidern hervorschauen, im Gesicht hatte er eine blutige Narbe vom Ohr bis zum Kinn, auf dem Rücken und den Oberschenkeln blutunterlaufene Stellen und blaue Flecken. Ich erinnerte mich an meinen Freund Janje, genau so hatte der ausgesehen, als man ihn erfroren in einem Graben auf dem Tuškanac gefunden hatte. Es gab aber dennoch einen Unterschied. Auf dem Rücken des Stiefvaters stand nicht JUDE geschrieben, mit roter Fettfarbe aufgemalt. „Was wollten sie?“, fragte die Mutter. „Das Geld, sie haben sich eingebildet, dass ich in betrügerischer Absicht die Millionen an mich gerissen habe“, antwortete der Stiefvater. Darauf sagte die Mutter: „Idioten!“ Der Stiefvater nickte: „Vielleicht bin ich ein Idiot, weil ich nicht in der Tat dieses Gesindel ausgeraubt habe.“ Die Mutter wurde ärgerlich, sie sah den Stiefvater durch ihre gesenkten Augenlider an, sie sagte kein Wort. Doch dann kam ihr berühmtes Lächeln, voller Verständnis. „Was haben sie mit dir gemacht?“, fragte sie. „Frag mich nie wieder danach“, antwortete er, mit einer mir unbekannten Stimme (er hatte noch nie so mit der Mutter gesprochen). „Gut, mache ich nicht“, sagte sie, ihre Stimme war weich und zärtlich.
Onkel Matija war der gleichen Meinung wie der Stiefvater: „Sie haben dich ordentlich vermöbelt, aber du hast es nicht anders verdient. Du hättest das Geld, das sie dir angeboten haben, nehmen sollen, jetzt wüsstest du wenigstens, warum sie dich zusammengeschlagen haben. Jetzt wäre die Lüge die Wahrheit, und nicht umgekehrt.“ Der Stiefvater versuchte zu lächeln, ließ es aber sein, wahrscheinlich tat ihm die Narbe im Gesicht weh. „Hätte ich es auch von dir leihen sollen?“, fragte er. „Mich hättest du nicht über den Tisch ziehen können, ich hätte mich vorher gut abgesichert“, sagte der Onkel selbstbewusst, dann wandte er sich an die Mutter: „Ihr müsst weg von hier. Ich bin viel in der Welt herumgekommen, ich weiß, wo man sich mit dem Gesicht hindrehen soll, und wo mit dem Rücken.“ Die Mutter sah ihn durch ihre gesenkten Augenlider an. „Danke für den Ratschlag.“ Der Onkel fuhr fort: „Du musst zurück nach Sombor. Dort sind dein Vater und deine Schwester. Sie hat genug Geld, sie kann dir helfen, bis du dich zurechtgefunden hast.“ Die Mutter setzte dem Gespräch ein Ende uns sagte bloß: „Danke, dass du so großzügig bist, auf Elizabetas Kosten.“
Tante Paulina unterstützte die Absicht der Mutter: „In Subotica werdet ihr es besser haben. Dort ist Flora, sie wird dir helfen, eine anständige Wohnung zu finden. Vielleicht bedeutet auch mein Name noch etwas in dieser Stadt. Ich bin sicher, dass ich dir gute Empfehlungen für die Musikschule besorgen kann.“ Buda war mit der Tante gekommen und hatte eine große Flasche Grappa mit, er wollte den Stiefvater sehen. „Was für Taugenichtse! Aber ich werde ihnen alles durcheinanderbringen, wenn sie dich noch einmal anfassen.“ Buda kochte vor Wut: „Verdammte Hurensöhne! Wenn dich jemand beleidigt, sag mir bloß Bescheid.“ Der Stiefvater versuchte, ihn zur Ruhe zu bringen. „Beruhige dich, Buda. Sie sind viele.“ Der Serbe aus der Lika erwiderte: „Auch wir aus der Lika sind viele! Wir werden sehen, wer stärker ist!“ Die Mutter mischte sich ein und sagte: „Danke für das Angebot, Buda, ich möchte nicht, dass mein Mann zum Anlass für einen Bürgerkrieg wird.“ Buda winkte gleichgültig ab: „Einen Krieg wird es sowieso geben, früher oder später.“
„Dann soll es ihn später geben“, meinte die Mutter.
Ich liege in einem großen Bett, im Gästezimmer von Tante Paulina. Das Fenster ist weit offen, es ist eine ruhige und laue Sommernacht. Die Straßenlaternen vom Platz beleuchten die hohe Decke und einen Teil der Wand, an der mein Lieblingsbild hängt. Es ist ein Fluss. Am Ufer, mit Schilf. Links sind hohe Pappeln zu sehen, rechts Buchen mit üppigen Baumkronen. Durch die Zweige der Weiden am gegenüberliegenden Ufer dringen Sonnenstrahlen durch, die auf der Wasseroberfläche in Tausenden Funken glitzern. Wie Sterne am Himmel. Ich nannte das Bild: Donau, bei Apatin. Die Tante sagte darauf: „Nein, das ist falsch, dieser Fluss ist sicher nicht die Donau.“ Ich fragte: „Woher weißt du, dass es nicht die Donau ist?“ Die Tante erwiderte: „Ich weiß nicht, woher ich das weiß!“ Später, als sie Buda ihre Bilder zeigte, hörte ich, wie sie sagte: „Und das hier ist die Donau, bei Apatin.“
Ich konnte nicht einschlafen. Das war ein fremdes Bett, ein fremdes Zimmer. Schon einige Nächte hatte ich bei der Tante geschlafen, weil die Mutter es so wollte. „In unserer Wohnung ist es nicht mehr sicher“, sagte sie, „auf der verlassenen Baustelle sind wieder böse Menschen aufgetaucht, und Onkel Matija hat gesagt, dass er einige zwielichtige Gestalten gesehen hat, die um unser Haus umherschleichen.“
Ich öffne die Augen, starre das Bild an, die Donau, die Funken, die auf der Wasseroberfläche glitzern. Ich überlege: Opa Josef ist mit Fischern auf diesem Fluss gefahren, hat diese Funken beobachtet, den Sternenhimmel betrachtet. Dann denke ich an meinen Vater: er ist da geboren; er hat in diesem Fluss gebadet, genau auf diesem Uferabschnitt ist er unter der Weide gesessen, unter der zweiten in der Reihe, auf der rechten Seite, noch sieht man die Spuren seiner nackten Füße im Schlamm. Ich kam gar nicht in Aufregung, als ich an den Vater dachte, ich hatte ihn seit Monaten nicht gesehen, er hatte mir keinen einzigen Brief geschrieben (ich ärgere mich sehr über ihn und finde, dass ich dafür gute Gründe habe).
Zuerst kam ein Brief von Tante Flora: „Kommt nicht nach Subotica“, schrieb sie an die Mutter, „dein Mann ist nun bei uns auf dem Esels-Jahrmarkt. Die hiesigen Zeitungen haben Nachrichten aus Zagreb über den Betrug in Millionenhöhe veröffentlicht, der mit dem Namen Buchwald in Verbindung steht. Viele Bewohner von Subotica erinnern sich noch an Jakov Buchwald, er ist hier wegen seiner Untaten berüchtigt. Unter solchen Umständen könntest du keine Arbeitsstelle finden, die Frage ist, ob du wenigstens eine anständige Wohnung mieten könntest.“ Die Mutter überlegte nicht lange, sie verwarf den Umzug nach Subotica. „Wohin gehen wir jetzt?“, fragte der Stiefvater, und ihre Antwort lautete: „Ich weiß nicht.“
Der Stiefvater wurde schweigsam, er fiel in eine schwere „Desperation“. Ich lud ihn zu einem Spaziergang ein, und er wollte an den Ort gehen, an dem er mich nach meinem Sturz abgeholt hatte. Auf dem Weg schwieg er die ganze Zeit. Als wir am Fuße des Abhangs ankamen, den ich hinuntergestürzt war, sagte er: „So, mein kleiner Freund, die Fäden meines Lebens sind durcheinandergeraten.“
Auch bei mir gerieten die Fäden des Lebens durcheinander. Schon hatte ich mich damit abgefunden, dass wir in Zagreb bleiben würden, als Tante Paulina eine viel bessere Lösung fand. Wahrscheinlich hatte sie ihre alten Bekanntschaften aus ihrer Wiener Zeit in Bewegung gesetzt. Für die Mutter wurde eine Arbeitsstelle gefunden, in Funktion einer Viršofterka (ein Ausdruck von Tante Paulina), das heißt: Leiterin des Haushalts, bei einem italienischen Grafen, in seinem Schloss am Ufer des Comer Sees. Der Graf hatte eine hohe Entlohnung angeboten sowie Unterkunft und Verpflegung nicht nur für sie, sondern auch für ihre Familie. Die Mutter war überglücklich, der Stiefvater blieb mürrisch, und ich ahnte ein großes Unglück.
Die Vermutung erfüllte sich bald. Der Vater gab keine schriftliche Zustimmung für meine Ausreise aus dem Land. Ohne diese Zustimmung konnte ich nicht über die Grenze kommen. Von Tante Paulina hatte ich gehört, dass Tante Elizabeta und Onkel Stevan den Vater besucht hatten, um ihm die Lage zu erklären, in der sich die Mutter befand. Der Vater hatte angeblich gesagt: „Sie kann unseren Sohn mitnehmen, wohin sie will – aber nur innerhalb der Grenzen dieses Landes. So haben wir es vereinbart, so steht es im Gerichtsbeschluss. Davon trete ich keinen Millimeter zurück.“ Elizabeta sagte: „Meine Schwester ist gezwungen, diesen Dienst anzunehmen, du wirst ihr doch nicht vom einzigen Sohn wegnehmen, den sie bei sich hat?“ Der Vater erwiderte: „Ich nehme ihr nicht den Sohn weg, sondern sie trennt sich von ihm.“ Stevan fragte: „Nimmst du ihn bei dir auf?“ Er erhielt keine Antwort, die Stiefmutter mischte sich ins Gespräch ein und sagte angeblich: „Dein älterer Sohn kann bei uns leben, wenn du das willst, aber der jüngere nicht, auf keinen Fall. Ich werde es nicht zulassen, dass er mein Leben kaputt macht.“
Ich betrachtete das Bild. Der Fluss war weiterhin reglos, aber mir schien, dass sich die Zweige der Buche im leichten Wind bogen. Ich hörte auch das Rascheln der Blätter, den Ruf eines einsamen Vogels und das Flügelgeflatter von Wildgänsen. Ich überlegte – wie sollte ich das Leben meiner Stiefmutter kaputt machen, was müsste ich tun, um jemandes Leben kaputt zu machen? Wenn ich in Sombor bin, frage ich Onkel Stevan. Ich dachte an den Onkel, an Sombor; an Kapi, an Oma Laura, um wenigstens einen winzigen Freudenschimmer vor der Reise zu erwischen, vor der Reise, die mich wieder von der Mutter trennen würde. Ich würde wieder gegenüber den hässlichen Spitalsgebäuden wohnen, gegenüber der Leichenhalle, nicht weit von dem Dickicht, in dem einst mein Bekannter gehaust hatte.
Opa Adolf war gekommen, um mich in sein Häuschen zu bringen, mit dem großen Obstgarten. An diesem Tag saßen alle in Tante Paulinas Speisezimmer beim Abendessen. Am meisten sprachen sie über die Juden, über ihr böses Schicksal. „Wir sind dazu bestimmt, ständig zu wandern. Wir können nicht länger als ein Jahrhundert an einem Ort bleiben“, sagte Tante Paulina. „Nicht einmal so lange“, korrigierte sie die Mutter. „Unlängst hat mir ein Flüchtling aus Deutschland gesagt: wo ein Jude seine Wiege hat, dort wird er sicher nicht sein Grab haben.“ Opa Adolf protestierte: „Das stimmt nicht, deine Vorfahren sind schon im achtzehnten Jahrhundert nach Sombor gekommen und alle sind dort begraben.“
„Ein seltener Fall, der Vater“, mischte sich auch Matija ein. „Es ist wahr, dass wir ständig umherziehen, und das ist deshalb, weil man uns nirgendwo gern aufnimmt. Das ist auch kein Wunder, da wir anders sind als die anderen. Wir haben anderes Blut, eine andere Abstammung.“
„Die Gojim mögen uns nicht, weil wir anständiger und maßvoller sind als sie, und dazu auch gottesfürchtiger“, trug Tante Irena vor wie eine gelernte Lektion.
„Das hast du schön gesagt“, lobte Matija seine Frau, „und was am allerwichtigsten ist, sind wir viel fähiger als sie und unvergleichlich klüger.“
Der Stiefvater schwieg den ganzen Abend, eigentlich hatte er den ganzen Tag kein Wort gesprochen. Endlich sagte er:
„Unsinn“, platzte er aus ihm heraus, so als würde ein anderer sprechen. „Was heißt denn Jude? Nichts, absolut nichts. Alles ist reinste Erfindung: Rasse, Religion, Nation. Alles! Es gibt kein anderes Blut und keine anderen Götter.“
Ich hatte den Stiefvater noch nie so reden gehört, als würde er aus einem Buch vorlesen. Die anderen hatten ihn so auch nicht gekannt. Alle schwiegen und sahen ihn verdutzt an. Der Stiefvater fuhr fort, als würde er eine Rede halten:
„Das Leben ist einzigartig und durchdringt alle Wesen auf diesem Planeten. Die Zeit hat es in Milliarden von Teilen zerlegt, aber jeder davon ist ein Teil des Ganzen. Alle Menschen sind nur ein Fleisch, ein Blut, alle wurden aus demselben Gefäß ausgeschüttet.“
Die Mutter sah vor sich, ruhig und gefasst. Sie kannte ihn auch als solchen, dachte ich mir, sie weiß, was mit ihm vor sich geht. Ich erinnerte mich, dass ich vor kurzem eine amerikanische Komödie gesehen hatte, in der ein unbedeutender Mensch einen harten Schlag auf den Kopf bekommt, plötzlich beginn er, sich mit Politik zu befassen und wird ein berühmter und mächtiger Staatsmann – bei der Polizei hat man meinen Stiefvater auf dem Kopf gehauen, überlege ich – deshalb ist in seinem Kopf etwas durcheinandergeraten und er wird ein berühmter Philosoph werden. (Onkel Stevan hatte mir in seiner Bibliothek Bücher berühmter Philosophen gezeigt, sie waren groß und angestaubt.) Mir gefiel es, wie der Stiefvater es gesagt hatte, das würde ich in mein Allerlei-Heft notieren, insbesondere das mit dem „Gefäß, aus dem wir alle ausgeschüttet wurden“. Ich sah das Bild an, der Fluss rauschte und die gebogenen Zweige wogten über dem Wasser – ein Fleisch, ein Blut, aus einem Gefäß ausgeschüttet …
Ich saß unter der Weide, am Rand des Ufers und beobachtete, wie der Fluss totes Laub forttrug und wie die Lichtfunken auf dem gekräuselten Wasser spielten. Auf dem gegenüberliegenden Ufer bog sich das Schilf rauschend in dem immer stärkeren Wind. Der Ruf eines einsamen Vogels, der sich eintönig, in immer gleichen Abständen wiederholte, machte mich schläfrig. Die Augen fielen mir zu, doch ich bemühte mich, nicht einzuschlafen, um Opa Josef begrüßen zu können. Er würde bald vom Fischen zurückkommen, in seinem kurzen, stumpfen Boot der Flussfischer …
Ich stand im leergeräumten Zimmer der Mutter und hörte die zauberhafte Melodie der Barcarole. Noch am Vortag hatte man das gesamte Mobiliar weggebracht, nur das Klavier war noch geblieben. Vom frühen Morgen an spielte die Mutter ununterbrochen. „Was soll ich dir vorspielen?“, fragte sie mich. Immer, wenn sie mich das fragte, sagte ich: „Die Barcarole, aber bis zum Schluss.“
In einer Ecke des leeren Zimmers standen zwei Koffer: ein brauner, alter, schon abgenutzter, und ein schwarzer, aus Leder, ein Geschenk von Onkel Stevan. Daneben eine große Kartonschachtel, mit einer Paketschnur verschnürt, in der meine Bücher verpackt waren. Der Stiefvater hatte mir geholfen, sie zu verpacken. Er schwieg dabei, und ich schwieg auch. Nachdem alles verpackt war, sagte er: „Deine Mutter und ich gehen nicht zum Bahnhof. Sie will das nicht. Weißt du, warum?“ Ich sagte: „Ich weiß es.“ Ich hatte am Vorabend gehört, wie sie zu Opa Adolf sagte: „Ich möchte euch nicht zum Zug bringen, ich will nicht zusehen, wie sich der Zug entfernt, der meinen Sohn wegbringt.“ Der Stiefvater war erleichtert, dass er mir nichts erklären musste. „Es ist üblich, dass beim Abschied Erwachsene Kindern einen Rat geben. Das ist dir wahrscheinlich bekannt“, sagte er. „Ja. Ich habe solche Szenen in Filmen gesehen“, erwiderte ich und wurde still. „Hat dir Tante Paulina etwas Lehrreiches gesagt, als sie sich von dir verabschiedet hat?“, fragte er. „Ja“, sagte ich, „sie hat gesagt, was auch immer dir passiert, du musst glauben.“ Der Stiefvater schwieg eine Weile, so als würde er überlegen, dann sagte er: „Wenn du unabhängig bleiben willst, musst du denken und nicht glauben. Das ist mein Rat.“ Ich sagte: „Das notiere ich mir in mein Allerlei-Heft.“ Das tat ich auch. Ich holte das schon verpackte Heft aus dem Koffer und notierte darin: „Wenn ich unabhängig bleiben will, muss ich denken und nicht glauben.“ In Klammern fügte ich hinzu: Andrija Knjigašuma, mein Stiefvater.
Ich stand im leeren Zimmer und betrachtete die Mutter. Sie sah mich nicht an, ihr Blick folgte den Fingern, die über die Tasten des Klaviers glitten. In einer halben Stunde würde ich mich von ihr verabschieden. Für wie lange? Für ein paar Monate? Oder ein paar Jahre? Vielleicht für immer? Die Mutter weinte nicht, auch ich musste die Tränen zurückhalten, obwohl ich am liebsten laut losgeschluchzt hätte. Sie hatte meine Gedanken gelesen und hob den Kopf, ihre Finger glitten weiterhin über die Tastatur. Sie sah mich an und lächelte, um mir Mut zu machen, dachte ich, aber in diesem Moment glitten Tränen ihre Wangen hinunter. Ich blieb weiterhin hart. Ich erwiderte ihr Lächeln, aber ich knickte nicht ein vor der Welle von Gefühlen, ich brach nicht in Tränen aus. Ich lauschte dem sanften Wellenschlagen, begleitet von eintönigen Rudern der venezianischen Gondolieri. Ich dachte mir, wenn ich doch die Zeit anhalten könnte, wenn dieser Augenblick stundenlang dauern könnte, tagelang, endlos. Aber wie soll man die Zeit anhalten? Eine Komödie aus dem Kino kam mir in den Sinn, in der der Protagonist Gefahr läuft, sich zu einer schicksalhaften Verabredung zu verspäten. Er läuft, während seine Freunde versuchen, die Zeiger der Kirchturmuhr anzuhalten. Das gelingt ihnen, die Zeit bleibt stehen und der Protagonist kommt rechtzeitig ans Ziel.
Ich lächelte bitter. Wer weiß, wie die Mutter dieses Lächeln interpretierte. Die Zeiger an der Uhr kann man anhalten, überlegte ich, aber die Zeit niemals, sie ist unaufhaltbar. Sie ist in ständigem Vergehen, in ständiger Bewegung, wie die Sterne. Im Zug nach Sombor notierte ich in mein Allerlei-Heft: „Die Zeit und die Sterne reisen zusammen, unaufhaltsam und ewig durch den Weltraum. (Wir, gewöhnliche Menschen, bezeichnen diese Reise durch die Ewigkeit als Vergänglichkeit.)“
NOTIZ IM NEUEN BLAUEN HEFT (ZAGREB, HERBST 1980)
Ich stand in der Laginjina-Straße, vor dem Haus Nr. 3. Das ist keine Sackgasse mehr, die verlassene Baustelle ist verschwunden, es wurden mehrstöckige Wohnhäuser gebaut, Baumreihen gepflanzt. Ich kenne mich nicht mehr aus in der Straße meiner Kindheit, doch das Haus Nr. 3 erkenne ich. Die Fassade ist dieselbe, und auch das Eingangstor, das Stiegenhaus ist ebenfalls dasselbe. An der Mauer gibt es keinen mit Kreide aufgemalten Davidstern, und auch nicht den Schriftzug: JUDENPACK RAUS.
Ich sehe zum Fenster von Mutters Zimmer im zweiten Stock. Ich schließe die Augen, versuche, die Wirklichkeit zu täuschen, das Bewusstsein auszuschalten, die Zeit zurückzudrehen, wieder die Klänge der Barcarole zu hören, wieder die zerreißende Trauer des Abschieds zu spüren. Ich spürte nichts, außer der Schwermut, die mich während meines ganzen Aufenthalts in Zagreb begleitet hatte; ich hörte nichts; ich war mir nur meine Hilflosigkeit bewusst. Ich erinnerte mich, wie ich in der Stunde des Abschieds darüber nachgedacht hatte, dass man die Zeit nicht anhalten kann, dass sie unaufhaltsam durch die Ewigkeit reist, gemeinsam mit den Sternen. Vierzig Jahre später, als ich unter dem heruntergekommenen Wohnhaus in der Loginjina-Straße stand, wusste ich, dass unser Fluch nicht darin bestand, dass die Zeit ständig und unaufhaltsam fortreist, sondern darin, dass man nicht durch die Zeit reisen kann.
NOTIZ. ERINNERUNGEN: FIGUREN AUS DER KINDHEIT.
TANTE PAULINA (OHNE DATUM)
Zwei Monate, nachdem wir Zagreb verlassen hatten, heiratete Tante Paulina Buda, den Serben aus der Lika. Sie hatten nicht lange zusammengelebt: im März 1941 wurde Buda zur Armee einberufen und Tante Paulina blieb alleine zurück. Der Krieg war schon absehbar. Tante Flora schrieb ihrer jüngeren Schwester, dass sie keine Zeit verlieren und auf der Stelle nach Subotica kommen solle, da man in Kroatien bereits sehr ungünstige Veränderungen erkennen konnte. Tante Paulina lehnte die Einladung ihrer Schwester ab, indem sie ihr ein Telegramm schickte: „Ohne Buda fahre ich nirgendwohin.“
Unser Krieg dauerte nicht lange. Tante Paulina beobachtete vom Fenster ihrer Wohnung aus, wie deutsche Soldaten wie Befreier über den Jelačićev-Platz marschierten, wo sie von begeisterten Bewohnern Zagrebs empfangen wurden. Noch am selben Abend statteten einflussreiche kroatische Freunde der Tante ihr einen Besuch ab und rieten ihr, sofort die Stadt zu verlassen und sich mit ihrer Hilfe nach Dalmatien abzusetzen, zu den Italienern. Tante Paulina bedankte sich und sagte: „Ohne Buda gehe ich nirgendwohin.“
Buda tauchte eines Nachts auf, zog sich um, steckte etwas Geld ein, packte ein paar Lebensmittel und eine Flasche Grappa ein und machte sich auf den Weg in seine Heimat, um „die serbischen Frauen und Kinder vor den Ustascha-Schlächtern zu verteidigen“. Beim Abschied versprach ihm Tante Paulina, auf ihre einflussreichen Freunde zu hören und schon am nächsten Tag nach Split zu reisen. Am nächsten Morgen gab sie ihren Freunden Bescheid, dass sie ihre Hilfe annehmen wolle, dass sie aber fünf Tage Zeit brauche, um ihre kostbaren Bilder einzupacken und an einen sicheren Ort zu bringen. In der folgenden Nacht brach die Polizei bei ihr ein und verlange von Tante Paulina, unverzüglich ihre Wohnung zu verlassen, die für die neue kroatische Obrigkeit benötigt wurde. Es war ihr erlaubt, einen Koffer mit persönlichen Dingen mitzunehmen, mit maximal 20 Kilogramm. Alles, was weiter folgt, ist die Zeugenaussage eines Polizisten, der im Dienst diesem Ereignis beigewohnt hatte und der im Jahr 1943 zu den Partisanen übergelaufen war und dort Buda, den Serben aus der Lika, begegnete.
Angeblich hatte Tante Paulina den Polizeioffizier gefragt, mit welchem Recht man sie aus ihrer eigenen Wohnung vertreibe. Der Offizier antwortete: „Sie sind Jüdin und haben gar keine Rechte.“ Daraufhin fragte die Tante: „Und was sind Sie, bitte schön?“ Der Offizier antwortete stolz: „Ich bin Kroate. Eine höhere Rasse.“ Tante Paulina erwiderte dreist: „Sie sind ein gewöhnliches Stück Scheiße vom Balkan, und keine höhere Rasse.“ Erstaunlicherweise schlug der Polizeioffizier nicht nach Tante Paulina, sondern schickte einen Polizisten nach Ustascha-Soldaten. Sie kamen sehr schnell. Sie waren bis auf die Zähne bewaffnet, überheblich und sehr laut. „Raus, du Judenhure!“, brüllten sie, „wenn du keine Lust hast, durch Stiegenhaus zu gehen, schmeißen wir dich beim Fenster raus.“ Angeblich war Tante Paulina nicht erschrocken. Sie hielt sich „majestätisch“, mit hocherhobenem Kopf, wie es sich für eine vornehme Dame gehörte, und sah die Ustascha-Soldaten verächtlich an, von oben herab, so wie sie früher ihre schmeichlerischen Verehrer angesehen hatte. Sie sagte, diesmal ohne „angeblich“, da ich meine Tante gut kenne und ganz sicher bin, dass die Aussage des Zeugen stimmt: „Wenn Sie mich töten wollen, müssen Sie das zweimal tun: zuerst als Jüdin und dann als Serbin.“
Sie töteten sie nur einmal.
-
Opa Josef führte mich durch einen Birkenwald, zu einer auflodernden Flamme, die aus einem hohen Schornstein vor uns hervorschießt. Die Sonne brennt über den Bäumen mit vertrocknetem und versengtem Laub. Nirgends ist Grün zu sehen, weder Gras noch Blätter, noch Knospen, nirgends bunte Blumen, um uns herum ist alles farblos, schmutzig, verfault. Aus der Tiefe des Waldes steigen dicke, rußfarbene Rauchsträhnen, sie verdunkeln die Sonne und verwandeln das Tageslicht in ein nebliges Grau der Dämmerung.
Vor uns stehen Reihen von Baracken. Wir gehen in die erste hinein. Wir gehen an ordentlich zusammengelegten Thora-Überzügen aus goldbesticktem Plüsch vorbei, an Gebetsschals und -ujmhängen, Decken für Hala und Mazzes, Hochzeitsbaldachins, Vorhängen aus kostbarem Atlas, die von Thoraschreinen stammten, rituellen Pokalen, Schofars aus blank poliertem Widderhorn, silbernen Leuchtern und Menoras. Wir gehen in die nächste Baracke. Um uns herum sind links und rechts Regale mit Prothesen zu sehen, der Größe nach sortierte Holzbeine und -arme, Prothesen, Gurte, Mieder. Die nächste Baracke ist bis zur Decke voll mit Taschen, Rucksäcken und Koffern; aus Karton, Stoff und Leder. Darauf sind mit Kreide die Namen ihrer Besitzer und ihrer Adressen aufgeschrieben, in Warschau, Krakau, Prag, Wien, Paris, Brüssel, Amsterdam, Thessaloniki, Skopje, Mailand, Triest, Zagreb, Budapest, Debrecen und Subotica. Wir sind schon in der nächsten Baracke. Die Vitrinen sind voll von Menschenhaar in allen Farben und Abstufungen; braun, hellblond, rot, silbern, schwarz, grau; da und dort, oben auf dem Haufen liegen Zöpfe, die fast an der Wurzel abgeschnitten und nicht entflochten wurden. In der Nachbarbaracke erwarten uns Puppen, in allen Größen; kostbare, aus Kautschuk und einfache, aus Stoff und Holz, oder aus Fetzen und Stroh. Tausende Augenpaare mit starrem Blick sehen mich an. Ich sehe weder nach rechts noch nach links, ich beeile mich, möglichst bald herauszukommen. Draußen erwarten mich Kinderwagen, in Fünferreihen aufgestellt, in Reih und Glied wie Soldaten.
Am Rand des weitläufigen Hofes befindet sich eine runde, offene Feuerstelle. Das Feuer ist gelöscht. Überall liegen Haufen von Büchern, Dokumenten, Fotos und Geldscheinen. Ein Foto erregt meine Aufmerksamkeit, ich nehme es in die Hand und betrachte es. Die Ränder sind versengt, das Foto ist vergilbt und fleckig, dennoch erkenne ich die Personen darauf. Am gedeckten Tisch, gedrängt an der Stirnseite, sitzen Opa Adolf und Oma Laura, links von ihnen Tante Elizabeta, ihr Sohn Ðorđe, der Stiefvater und die Mutter, an der rechten Seite Onkel Matija, Tante Irena, ihr Sohn Robert und am Ende der Reihe ich. Alle lächeln, nur ich bin ernst, mürrisch, schwermütig. Alle Blicke sind ins Objektiv der Fotoapparats gerichtet, nur ich sehe daran vorbei, irgendwo zur Seite – zu mir.
Es war Herbst, es kamen die Feiertage, zuallererst das Neujahrsfest, Rosch ha-Schana. Nach dem jüdischen Kalender begann das Jahr 5702, und nach unserem regulären, dem alltäglichen, war doch erst 1941. Ich fragte Onkel Stevan, warum gerade 5702. Was ist vor fünftausendsiebenhundertzwei Jahren passiert? Er erklärte mir, das sei der erste Tag der Welterschaffung, wie es geschrieben steht: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde …“ Er zitierte wieder aus den heiligen Büchern, wieder war ich mir nicht sicher, ob er scherzte oder ernsthaft sprach, daher wollte ich eine zusätzliche Erklärung, woher man den wisse, dass dieses Ereignis genau vor 5702 Jahren stattgefunden haben soll. „Wer hat das notiert?“, fragte ich. „Frag das deinen Religionslehrer“, antwortete der Onkel. „Bin doch nicht verrückt“, sagte ich, „dafür kriege ich ein paar Ohrfeigen.“
In der Religionsstunde erklärte uns der Schönberger, dass Rosch ha-Schana eigentlich der Tag des himmlischen Gerichts sei. „Im Himmel öffnen werden drei Bücher aufgeschlagen und darin wird das Schicksal jedes Einzelnen eingetragen, deshalb sollte man sich ein gutes neues Jahr mit folgenden Worten wünschen: L’Schana tova tikatevu, das heißt: Seid eingetragen für ein gutes neues Jahr. Das ist das Erste. Zweitens ist das kein Fest der Lustbarkeit und Freude, sondern ein Fest der tiefen Ernsthaftigkeit und der moralischen Verantwortung. Daher solltet ihr, ‚eine Lausbuben-Bande‘ vor der Synagoge nicht brüllen“, donnerte der Schönberger und spuckte dabei ausgiebig, „denn das wird euch sowohl bei Herrgott als auch bei mir teuer zu stehen kommen.“
Von Onkel Bela hatte ich eine etwas andere Deutung gehört. Laut ihm richtet Gott nicht nur, sondern führt auch die Rechnungen all seiner Geschöpfe zusammen; sowohl ihrer Wohltaten als auch ihrer Übeltaten, sodass Rosch ha-Schana vor allem ein Tag der Erinnerung ist. Gleichzeitig aber auch der Tag der Bestätigung des neuen Lebens – deshalb singt man beim Gottesdienst den Psalm: „Erinnere dich an unsere Leben, du König, trag uns ein ins Buch des Lebens, deinetwegen, du Gott des Lebens.“
Beim Gottesdienst war die große bzw. Sommersynagoge voll von Gläubigen. Dieses heruntergekommene Gebäude, das von außen eher an eine Tanzschule erinnerte (laut Opa Adolf) als an einen Tempel Gottes, stand das ganze Jahr über leer, bis zu den Herbstfeiertagen. Daher stammte wohl auch der Spruch des Stivo Sten, der bald bei allen üblich wurde: „Sein Kopf ist so leer wie die Synagoge von Sombor.“
Meine ganze Verwandtschaft war anwesend, bis auf Opa Adolf. „Was soll ich unter so vielen Gerechten, ich möchte nicht ihren Durchschnitt nach untern drücken! Ich werde beim Festessen dabei sein und das ist von meiner Seite genug“ (sagte er dreist zu meiner Mutter, als sie ihn zum Abendgottesdienst eingeladen hatte). Ich muss gestehen, dass ich ihn beneidete, während ich schwitzte, zwischen meinem Bruder und meinem Vater eingezwängt, und mich nach frischer Luft sehnte. Mit dem Blick suchte ich nach meinem Stiefvater. Er stand ganz hinten, von den anderen getrennt, absichtlich übersehen. Am Beginn des Gottesdienstes war nur Onkel Stevan auf ihn zugekommen und schüttelte ihm auffällig die Hand. Die anderen bemerkten ihn nicht, oder waren bemüht, ihn nicht zu bemerken. Er stand die ganze Zeit allein da, sein Blick war reglos ins Gebetsbuch gerichtet, er war scheinbar ins Gebet vertieft, doch ich wusste, dass er weder an das Fest dachte noch an den Allerhöchsten, sondern dass seine Gedanken durch noch unerforschte Gebiete seiner Fantasie schweiften. Am liebsten wäre ich zu ihm hingegangen und hätte mich zu ihm gestellt, allen anderen zum Trotz, dennoch habe ich das nicht getan, weil mein Vater eine solche Geste wahrscheinlich falsch verstanden hätte.
Am Neujahrsabend versammelte sich bei Tante Elizabeta die Familie Seidner in voller Besetzung am festlich gedeckten Tisch: Opa Adolf und Oma Laura, Onkel Matija mit seiner Frau Irena und dem Sohn Robert, die Mutter und der Stiefvater, Onkel Stevan mit Tante Elizabeta und dem Sohn Ðorđe. Und ich, natürlich. Zuerst aß jeder ein Stück Apfel, das er vorher in Honig getunkt hatte (damit uns das kommende Jahr süß würde), dann eine Ragout-Suppe aus Hühnerklein mit Grießnockerln, und als Vorspeise gab es Mutters berühmte kalte Gänseleber, mit Knoblauch gespickt, danach aß man Gefillte Fisch (damit wir uns wie die Fische vermehrten) mit einer Soße aus Dille, Petersilie und Knoblauch, darauf folgte Gänse- und Truthahnbraten mit Meerettichsoße, Weichselkompott, Bratkartoffeln und verschiedenen Salaten; dann der Neujahrskuchen mit Honig und Rosinen, dazu Rotwein, dann eine Rumtorte und schließlich die unverzichtbaren Granatäpfel (damit die Zahl unserer guten Taten so groß würde wie jene der Kerne in der Frucht). Alles war „nach Vorschrift“ (ein Ausdruck von Opa), wie es der Ritus und der Brauch verlangen, es fehlte nur der Schafskopf, damit wir Köpfe würden und nicht Schwänze. „Auf meinen Tisch kommt etwas so Abstoßendes und Hässliches nicht“, meinte meine Mutter. Dabei blieb es.
Wir waren gerade beim Kuchen mit Honig und Rosinen (die Mutter schenke gerade den Wein ein), als Tante Elizabeta ihren Bruder fragte: „Hast du irgendwelche Nachrichten aus Zagreb?“ Onkel Matija antwortete kurz: „Schlechte.“
„Etwas über Tante Paulina?“, fragte die Mutter.
Ich merkte, dass ihre Hand zitterte, in der sie ein Glas Wein hielt. „Ich habe keine Nachrichten von ihr, aber ich habe gehört, dass Zagreber Juden verhaftet, ausgeraubt und in Lager deportiert werden“, erwiderte Matija mürrisch (mit einer Bitterkeit, als würde er keinen Honigkuchen essen, sondern einen mit Wermut). Elizabeta schüttelte den Kopf, so schnell, dass ich dachte, sie würde sich den Hals verrenken.
„Nein, ich kann das nicht glauben, nein, nein“, wiederholte sie.
Zu meiner großen Überraschung, und wahrscheinlich nicht nur zu meiner, unterbrach die Mutter das Gestammel der Tante, ohne dabei ihren Zorn zu verstecken:
„Warum kannst du das nicht glauben? Was hast du sonst von den verdammten Deutschen erwartet!“
Ich war sprachlos. Bis zu diesem Moment hatte ich in der Überzeugung gelebt, dass meine Mutter die Deutschen nicht hasste. Sie hatte Goethe, Schiller und Thomas Mann gelesen, manche Gedichte Heines konnte sie auswendig; sie spielte gerne Schubert, Schumann und Händel, und genauso wie ich liebte sie Offenbachs Barcarole über alles. Ich hatte nicht genug Zeit, mich zu wundern, da Onkel Matija dieses Mal sich selbst übertraf, er war schneller.
„Entschuldige mich, das sind keine Deutschen, sondern Kroaten. Deutsche Soldaten würden keine solche Schweinereien machen.“
Ich fragte mich, ob er aus Überzeugung so sprach, oder um sich bei seinem Vater einzuschmeicheln. Nicht nur wegen seiner Frau, einer Deutschen, sondern auch wegen Großvaters Voreingenommenheit gegenüber Deutschen. Er war immer stolz auf die Herkunft seiner Vorfahren aus Preußen und ließ es nicht zu, dass irgendjemand die preußische Ritterlichkeit in Abrede stellte, ihre Disziplin und Pedanterie. Seiner Meinung nach waren die Hauptschuldigen an Zerstörung und Verbrechen Herr Schicklgruber und seine Österreicher, und nicht die Deutschen, schon gar nicht die Preußen. Ich war mir nicht darüber im Klaren, ob er recht hatte, außer unserer einheimischen Schwaben kannte ich keinen einzigen echten Deutschen. Einen hatte ich zwar einmal gesehen, vor langer Zeit, in der Pension meiner Mutter in Zagreb. Einer der ständigen Bewohner hatte ihn zum Mittagessen mitgebracht. Ich erinnere mich, dass er großgewachsen war, sich gerade hielt, sich vor jedem steif verbeugte, sogar vor mir, dass er ständig „danke, danke“ sagte, und der Moment hat sich bei mir tief ins Gedächtnis eingeprägt, als am Tisch Obst serviert wurde. Er betrachtete lange und misstrauisch seine Scheibe Wassermelone, dann aß er sie, mitsamt der Rinde und den Kernen. Als ich Opa Adolf von meiner Erfahrung mit den Deutschen erzählt hatte, sagte er barsch: „Das war sicher ein bayrischer Bauerntölpel und niemals ein Preuße.“
Ich hatte erwartet, dass jemand von den Anwesenden Matijas Verteidigung der deutschen Soldatenehre abstreiten würde, aber es wurde nichts daraus. Onkel Stevan setzte gerade an, seinem hoffnungsvollen Schwager Paroli zu bieten, als ihn Tante Elizabeta am Ärmel zog und ihm zuflüsterte, allerdings zu wenig leise, als dass ich es nicht gehört hätte: „Sei still, gieß nicht noch Öl ins Feuer.“
Ich hatte noch nie gesehen, dass Onkel Stevan sich seiner Frau widersetzt hätte, er tat es auch diesmal nicht, dennoch fand sich eine andere Person, die Öl an die richtige Stelle goss. Die gnädige Frau von Batschki Monoschtor, natürlich. Sie tat es nicht, um die Flamme zu entfachen, sondern im Gegenteil, um sie zu löschen. Sie tat es wie jeder Narr, der mit aller Kraft in die Flamme blies, um das Feuer zu mäßigen. So war sie immer schon gewesen. Sie schüttete Salz ins Meer, grub eine Brunnen am Flussufer aus, oder sie schleppte Holz in den Wald; Andrija pflegte über sie zu sagen: „Sie ist dumm wie die Sonnenfinsternis“ Bis Onkel Stevan bei einer Gelegenheit sagte, sie sei dumm wie eine Aubergine. „Warum wie eine Aubergine? Ist eine Aubergine wirklich dumm?“, fragte ich. „Ist sie denn etwa klug?“, antwortete der Onkel mit einer Gegenfrage. Ich sagte dann drauflos, da mir nichts Besseres eingefallen war: „Eine Aubergine hat kein Gehirn.“ „Deine Tante hat auch keines“, schlussfolgerte Onkel Stevan aus unserer Diskussion.
Was hatte also Tante Irena an diesem Festabend gesagt? Genau fünftausendsiebenhundertzwei Jahre nach der Erschaffung der Welt. Sie sagte: „Mein Mann hat recht, die Deutschen sind eine Kulturnation. Denkt bloß an Goethe und Beethoven.“
Es ärgerte mich sehr, dass man Onkel Stevan „ein Schloss vor den Mund gehängt hatte“ (wie meine Mutter zu sagen pflegte), sodass er die gottgegebene Gelegenheit nicht nutzen konnte und die Aubergine fragen, ob sie Beethovens Gedichte oder Goethes Sinfonien meine? Erstaunlicherweise sprach der Onkel trotz Verbot, wenn auch kurz: „Beethoven und Goethe sind schon lange tot“, sagte er.
Klarerweise konnte es nicht dabeibleiben, die Tante musste das letzte Wort haben. „Stevan, mein Lieber“ (sagte sie, indem sie den Ton erhob, als würde sie ein Rezitativ aus einer von Operetten meines Vaters aufsagen), „sie sind vielleicht tot“ (warum vielleicht, dachte ich mir), „aber unter den Deutschen lebt immer noch ihr edler Geist.“
Gut, jubelte ich, die Sturzflut geht los, man kann sie nicht mehr aufhalten, schon gar nicht mit den Verkehrszeichen meiner Tante. Ich hatte mich nicht getäuscht, Onkel Stevan ging in einen Angriff über: „Da täuschst du dich!“, sagte er (besser, er hätte es nicht gesagt, dachte ich), „es gibt keinen edlen Geist dort, wo man die Ideen eines Idioten aufnimmt und seine wahnsinnigen Aufrufe zur Eroberung der Welt.“
Weiter ging es ganz von alleine, Matija wäre nicht Matija gewesen, wenn es nicht auch noch seinen Senf dazugegeben hätte. Er konnte es nicht ertragen, wenn man zu seiner Frau sagte, dass sie sich irrte, er war der Meinung, dass sie immer im Recht war.
„Unsinn“, sagte er selbstbewusst, „um Hitler hat sich bloß eine kleine Gruppe an Fanatikern versammelt. Der Großteil der Deutschen ist vollkommen vernünftig, weil sie ein tiefsitzendes Gefühl für die Moral besitzen.“ Klarerweise gab Onkel Stevan nicht auf, obwohl ihn seine Frau schonungslos unter dem Tisch mit dem Fuß trat. „Ein Volk, selbst wenn es ein ‚Herrenvolk‘ ist, das in den anderen die Quelle seiner Not und seiner Misserfolge sieht, ist mit dem Keim einer schrecklichen Krankheit ‚infiziert‘, die zur völligen Lähmung des Verstands und der Moral führt.“
Es war an der Zeit, dass sich auch Opa Alfred einmischte, auf der Seite seines Sohnes, natürlich, obwohl man sah, dass er übellaunig war. „Ich finde, dass Matija recht hat. Das deutsche Volk besitzt ein tiefsitzendes Gefühl für die Moral, erinnert euch an Goethes Worte: die moralische Größe ist entscheidend“, führte er aus.
„Das ist wahr, Goethe hat das geschrieben. Das Problem liegt darin, dass die Deutschen lieber Mein Kampf lesen als Goethe“, ließ der Onkel vernehmen, trotz Redeverbot.
Ich war zufrieden.
Der Stiefvater, der die ganze Zeit geschwiegen hatte, als würde ihn das Geplänkel während des Mittagessens kein bisschen interessieren, sagte plötzlich: „Bevor ihr eure Diskussion fortsetzt, muss man verlässlich feststellen, ob deutsche Nazisten Menschen sind oder bloß eine Kopie des Menschen mit dem Gehirn eines Alligators und den Emotionen einer Ratte.“
Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich laut applaudiert, leider konnte ich das nicht. Alle schwiegen, also schwieg auch ich, und der Vater und der Sohn bereiteten sich auf einen Gegenangriff vor. Bevor Opa Alfred wieder geistesgegenwärtig wurde und noch bevor der träge Matija sich eine möglichst verletzende Antwort überlegen konnte, sprach die Mutter als Erste: „Genug vom gegenseitigen Übertreffen. Wir wollen doch nicht in der Neujahrsnacht streiten? Kein Wort mehr.“
Das war ein Befehl, aber ebenso ein Vorwurf. Wenn sie etwas verlangte, widersetzte sich ihr niemand aus der Familie Seidner. Nicht einmal Matija. Sie hatte die Rolle der verstorbenen Großmutter Helena übernommen, die einst das Oberhaupt der Familie war, allerdings erteilte die Mutter, im Unterschied zur Großmutter, nur sehr selten ihre kurzen Befehle. Zur Sicherheit kam ihr ihre Schwester zu Hilfe: „Es ist Zeit, Fotos zu machen“, sagte sie.
Wir drängten uns an die Stirnseite des Tisches. Onkel Stevan schaltete alle Lichter im Speisezimmer ein, stellte den Fotoapparat auf das Stativ und bereitete den Blitz aus Magnesium vor. In diesem Moment spürte ich, wie meine Hände eiskalt wurden und wie der Schrecken langsam meine Arme hinaufkroch, meine Schultern und meine Brust erfasste – es geht los, dachte ich mir – jetzt wird die Zeit stehenbleiben und alle werden zu Eis erstarren. Es geschah nichts. Onkel Stevan stellte sich von einem Bein aufs andere und suchte nach der besten Position zum Fotografieren, dabei hörte ich das Gekicher von Tante Irena und Gesprächsfetzen, die ich nicht verstehen konnte. Im nächsten Augenblick wurde mir klar, dass ich das alles schon einmal erlebt hatte (wir sitzen beim Neujahrsfestessen und blicken konzentriert ins Objektiv des Fotoapparats: an der Stirnseite Opa Adolf, neben ihm Oma Laura, rechts von ihnen Matija, Irena, Robert und ich, links Tante Elizabeta, Ðorđe, der Stiefvater und die Mutter, alle lächeln, nur ich blicke ernst und mürrisch drein). Ich versuche, mich zu erinnern, wann ich all das erlebt habe, doch die eisige Kälte lässt nicht nach, sie hat auch meine Beine erfasst, sodass ich sie nicht bewegen kann, als wären sie erfroren.
Ich höre, wie uns Onkel Stevan ermahnt, uns nicht zu bewegen, und das Aufblitzen des Magnesiums blendet mich. Ich schließe die Augen. Das blitzende Licht dauert noch an, aber das ist nicht mehr das Leuchten des Blitzes, sondern die Sonne, die über dem Birkenwald brennt. Mir ist warm (ich sehe mich, wie ich neben der gelöschten runden Feuerstelle stehe, mit einer angesengten Fotografie in der Hand: der Tisch im Speisezimmer, darum gedrängt Opa Adolf, Oma Laura, Tante Elizabeta, Ðorđe, der Stiefvater, meine Mutter, Matija, Irena, Robert und ich, ernst und mürrisch). Das ist ein Traum – ruft eine unbekannte Stimme in mir – das ist nicht die Wirklichkeit, das ist ein Traum.
Ich sitze mit geschlossenen Augen im Dunkel. „Was ist mir dir los? Geht es dir nicht gut?“, höre ich die Stimme der Mutter. „Es geht mir gut“, sage ich und öffne die Augen. Ich stehe auf und gehe ans Fenster, ich sehe auf die dunkle, menschenleere Straße hinunter. Der Regen prasselt nieder. Auf dem Dach des Hauses gegenüber steht ein Mann, der Regen scheint ihn nicht zu berühren, er läuft an ihm vorbei, als wäre er durch eine unsichtbare Wand geschützt. In der Dunkelheit kann ich ihn nicht erkennen, aber ich weiß, dass er mich anschaut. Ist das Opa Josef? Oder Elijahu? Träume ich? Was ist die Wirklichkeit, und was der Traum? Am nächsten Morgen notiere ich ins Blaue Heft: „Ist meine Wirklichkeit eine große Lüge, bloß eine trügerische Erinnerung? Und mein Traum die einzige Wahrheit?“
Am Sonntag, dem siebten Dezember, notierte ich in mein Kriegstagebuch: Die Japaner haben Pearl Harbor angegriffen, die amerikanische Militärbasis auf Hawaii. Vier Tage später erfolgte ein weiterer bedeutender Eintrag: Deutschland und Italien haben Amerika den Krieg erklärt. Und am Samstag, dem dreizehnten, wurde notiert: Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und die Slowakei haben den Vereinigten Staaten und Großbritannien den Krieg erklärt. Einen kurzen Kommentar setzte ich in Klammern: (ha, ha, ha).
Einen Tag später kamen Agenten der Geheimpolizei und nahmen Onkel Stevan mit. Zwei Wochen später wurde eine Gerichtsverhandlung abgehalten, die einen ganzen Vormittag in Anspruch nahm. Am nächsten Tag wurde das Urteil gesprochen: „Wegen dem Feind dienender Betätigung wird Istvan Lukacs zu sieben Jahren strengen Kerker verurteilt.“
Bei der Gerichtsverhandlung, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, war endlich der Kronzeuge erschienen, ein „gewissenhafter Bürger“, der den Gesetzesübertreter angezeigt hatte, und, wie in einem schlechten Drehbuch mit einer überzogenen Geschichte, hatte den Onkel Stevan sein bester Freund denunziert. Keinen Moment lang hatte er daran gezweifelt.
Istvan und Karoly wurden im selben Jahr geboren, in derselben Stadt, in Eger, im Nordosten Ungarns. Gemeinsam besuchten sie die Grundschule und die gymnasiale Unterstufe, dann machten sie beide eine Lehre als Gerber. Später wählte Istvan das Taschnerhandwerk, Karoly wurde Kürschner und Pelzmantelschneider. Nach der Meisterprüfung gingen sie beide nach Budapest, um ihre Handwerkskünste zu perfektionieren. Die ganze Zeit waren sie wie Brüder, so wurden sie auch genannt – Brüderfreunde. Sie trennten sich auch dann nicht, als sie ein neues Leben begannen und sich in Sombor ansiedelten, der Stadt, die zu dieser Zeit ein Treffpunkt der Handwerker und Händler war. Sie heirateten im selben Jahr und waren einander Trauzeugen. Istvan, jetzt schon Stevan, eröffnete ein Geschäft für Lederwaren, und Karoly, liebevoll Karcsi genannt, eine Kürschnerei, in der Pariser Straße. Ihre Freundschaft hielt weiter an, sie nannten einander „komam“.
Onkel Stevan hatte seinem unzertrennlichen Freund und Trauzeugen wahrscheinlich hunderte Witze erzählt, von denen einer verhängnisvoll war. Bei der Gerichtsverhandlung wurde der Witz bekannt gegeben, samt dem strengen Verbot, ihn an die Öffentlichkeit zu tragen. Laut Aussage des Anwalts des Onkels hat Karoly vor der Gerichtsversammlung unter Eid bestätigt, dass sein Bekannter, es wurde nicht „Freund“ gesagt, den berüchtigten Witz erzählt habe. „Man konnte nichts machen“, meinte der Anwalt, „das Urteil wurde noch vor Beginn der Verhandlung gefällt.“ Noch bevor das Urteil rechtskräftig war, wurde Onkel Stevan in die Festung von Komárom überstellt, ins Gefängnis für die schwersten politischen Gefangengen. Er war nun ein Sträfling, jeder Kontakt zu ihm wurde unterbrochen.
Tante Elizabeta hatte diesen Schicksalsschlag sehr schwer aufgenommen; Makuli hätte so einen Schlag als einen Direkt in den linkem Plexus bezeichnet, von dem man oft tot umfiel. Meine Mutter trennte sich kaum von ihrer Schwester, sehr oft hatte sie bei ihr geschlafen. Die Nachricht von der Verhaftung und das Urteil verbreitete sich in der ganzen Stadt und brachte viel Unruhe, nicht nur unter Juden und Serben, sondern auch unter zahlreiche Ungarn: „Dieses Urteil hat weder mit Wahrheit noch mit Recht etwas zu tun. Das ist höchst abstoßende Einschüchterung!“, sagte mein Vater, und die Stiefmutter sagte darauf: „Nur noch ein weiterer Beweis, dass man vom Schweigen keine Kopfschmerzen bekommt.“ Opa Adolf hatte nicht das Urteil kommentiert, sondern das Verhalten des ehemaligen Freundes des Onkels. „Dieser Typ hat lange Zeit seinen wahren Charakter versteckt, aber so, wie ein wahnsinniger Mensch sich wahnsinnig verhalten muss, so muss sich ein gemeiner Mensch gemein verhalten.“ Der Stiefvater versuchte, wenigstens einen schmalen Lichtstrahl in der Finsternis zu entdecken, also sagte er zu mir: „Man weiß nicht, worauf das hinauslaufen wird. So wie es in jedem Guten etwas Böses versteckt, so verbirgt sich auch in jedem Schlimmen immer auch etwas Gutes.“ Etwas Ähnliches sagte auch Onkel Matija, nur geschmackloser / unangemessener: „Das alles ist gar nicht so schlecht. In den Gefängnissen kommt man heutzutage am wenigsten ums Leben.“ Die Mutter sagte gar nichts, und ich traute mich nicht zu fragen, von welcher Farbe denn die Seele des Meisters Karoly sei, obwohl mich das sehr beschäftigte. Ich stellte fest, dass sie höchstwahrscheinlich „schwarz“ wie Teer sei, wie ein Leichentuch, wie der Boden eines Abgrunds.
Eines Tages gegen Mittag nahmen Kapi und ich Stellung in einem Torbogen gegenüber dem Kürschnerladen in der Pariser Straße. Mein Freund wollte Karoly sehen, ihn aus der Nähe betrachten. Als dieser aus dem Laden herauskam, sahen wir einen Mann, wie wir sie jeden Tag hundertmal sehen konnten: dünn, mit kleiner Glatze, mit einem spitzen Schnurrbart, wie er oft von Barbierlehrlingen getragen werden. „Ein gewöhnlicher Gestank von einem Menschen“, sagte Kapi enttäuscht. „Er hat weder Hörner, noch Hufe, noch einen Ziegenbart.“ Ich sagte: „Wenn er ein Teufel wäre, wären alle Probleme gelöst, so aber verstehe ich gar nichts.“
Ich verstand auch wirklich gar nichts. Ich fragte mich, warum Karoly seinen Landsmann in den Abgrund gestoßen hatte, seinen Trauzeugen und Freund? Welche Gründe haben ihn dazu geführt oder gezwungen? Onkel Stevan hatte ihn niemals beleidigt, oder ihn bedroht oder erpresst, er war weder sein Schuldiger noch sein Gläubiger, er war nicht wohlhabender als Karoly noch in einer höheren beruflichen Position. Es gab keinen einzigen Grund für Rache, Neid, Eifersucht oder Hass.
Es wurde Böses getan, um Böses zu tun.
An diesem Abend notierte ich in mein Blaues Heft: „Woher kommt das Böse – aus welchem Samen ist es entstanden – und wie ist es in unsere Welt hineingekrochen?“
NOTIZEN, ERINNERUNGEN.
FIGUREN AUS DER KINDHEIT: ONKEL STEVAN
Onkel Stevan verbrachte in der Festung Komárom, oder Komarno, fünf Monate in strenger Isolationshaft. Es war ihm verboten, Briefe und Pakete zu empfangen, und er konnte nur eine Postkarte pro Monat schicken. Im Frühling 1942 wurde er in ein Gefängnis in der Stadt Sátoraljaújhely versetzt, unter Kriminelle. Seine Lage verbesserte sich deutlich: es war ihm nun erlaubt, Briefe und Pakete zu empfangen, und einmal pro Monat sogar Besuche. Unter den Sträflingen war er äußerst beliebt, es gelang ihm, selbst den waschechten Kriminellen zu guter Laune zu verhelfen / gut zu stimmen. Im folgenden Jahr verhielt man sich ihm gegenüber, als wäre er ein langgedienter Häftling: er bekam eine Einzelzelle und die Erlaubnis, dreimal pro Jahr seine Frau zu einem ganztägigen Besuch zu empfangen.
Der Stiefvater behielt recht: das Schlimme hat immer auch etwas Gutes. Erstaunlicherweise hatte sich auch Onkel Matija nicht geirrt: Für Juden war das Gefängnis bald zum sichersten Ort geworden, darin kam man am wenigsten ums Leben. Zum ersten Mal war Onkel Stevan seinem Schicksal im Herbst 1942 entkommen, als alle Juden aus Sombor im Alter von zwanzig bis vierzig Jahren mobilisiert und in Arbeitsbrigaden eingeteilt wurden, die Minen entfernen und Festungsanlagen für das Militär an der Ostfront bauen mussten. Da er ein Sträfling war, wurde er von der Mobilisierung nicht erfasst, höchstwahrscheinlich entkam er so dem Tod.
Das nächste Mal überlistete er sein Schicksal im April 1944: der ungeheure Sturm des Großen Umsturzes hatte den Sträfling Istvan Lukacs umgangen. Es war zwar eine Staatskommission, bestehend aus drei Mitgliedern, gekommen, um zu überprüfen, ob es im Gefängnis jüdische Gefangene gab, sie fand jedoch keinen einzigen. Keiner von den Häftlingen und Aufsehern hatte Istvan Lukacs verraten. Die Kriminellen hatten mehr Gewissen und Gerechtigkeitssinn als ein angesehener und tüchtiger Kleinbürger aus Sombor.
Am selben Tag, an dem die Rote Armee in Sátoraljaújhely einmarschiert war, ließ der Gefängnisleiter seinen einzigen jüdischen Häftling frei und bat ihm beim Abschied, den Ungarn die Ungerechtigkeit zu verzeihen, die sie ihm angetan hatten. Onkel Stevan kehrte auf einem sowjetischen Militärlastwagen nach Sombor zurück, als erster Jude, der den Großen Umsturz überlebt hatte. In seiner Wohnung fand er einen Armeestab vor. Er fand einige Möbel und fast seine ganze Bibliothek unberührt vor. Das waren Zeiten, in denen ein Buch keinen Wert hatte, es konnte nur zum Feuermachen nützlich sein. Bei seinen serbischen Freunden fand er seinen Familienschmuck vor, die Tante Elizabeta rechtzeitig dort untergebracht hatte. Das waren Freunde von einem anderen Schlag als Meister Karoly. Die Stadtverwaltung teilte ihm eine Zweizimmerwohnung in der Valjevska-Straße zu. Er hatte gerade so viele Möbel gehabt, dass er die beiden Zimmer einrichten konnte, aus der Küche hatte er eine Bibliothek gemacht.
Eine Woche nach seiner Rückkehr kleidete er sich „en gala“ und machte sich mit einem Spazierstock in der Hand auf den Weg in die Pariser Straße. In der Kürschnerei fand er den Besitzer vor, der sich seit ihrem letzten Treffen überhaupt nicht verändert hatte, außer dass er nun drei Jahre älter war. „Servus, Karcsi koma“, grüßte ihn der Onkel wie einst in den alten Zeiten, die in diesem Augenblick ferner schienen als die biblische Sintflut. Der „Karcsi koma“ grüßte nicht zurück. Er war blass, seine Hände zitterten, seine Zunge war erlahmt. Es sprach nur Steve Stan. „Ich werde dir den neuesten Witz erzählen. Du wirst vom ganzen Herzen lachen“, sagte er. Er erzählte den Witz, einen „politischen“, einen groben Scherz gegen die Partisanen, die Kommunisten oder den Marschall Tito, das ist mir nicht bekannt. Der Onkel hat mir gegenüber später zugegeben, dass er sogar noch stupider war als derjenige, für den er sieben Jahre Haft ausgefasst hatte. Trotzdem lachte Karoly nicht. Steve Stand auch nicht. Im Gegenteil, er war vollkommen ernst. „Ich lasse dich eine Auswahl treffen“, teilte er seinem ehemaligen „Bruderfreund“ mit. „Du hast zwei Möglichkeiten. Die erste lautet: du wirst mich nicht bei der OZNA anzeigen. In diesem Fall lasse ich sie wissen, dass ich dir einen politischen Witz erzählt habe, um dich zu provozieren, und du es versäumt hast, deiner bürgerlichen Pflicht nachzukommen. Die andere Möglichkeit: du zeigst mich wieder an. In diesem Fall gewähre ich der OZNA Einblick in mein Gerichtsurteil, in dem du als Kronzeuge angeführt bist. Los, such es dir aus.“ Karcsi fiel in Ohnmacht, und Onkel Stevan spazierte ruhig aus dem Laden heraus. Diesem Vorfall hatte auch der Kürschnergehilfe beigewohnt. Einige Tage später redete die ganze Stadt über den neuesten Scherz von Steve Stan, den, wahrscheinlich zum ersten Mal, niemand lustig fand. Bals wurde der Kürschnerladen in der Pariser Straße verkauft, und sein Besitzer, der tüchtige Lederer- und Kürschnermeister aus Eger, war aus der Stadt verschwunden, ein für alle Mal.
Nach meiner Rückkehr aus der Welt der Dunkelheit und des Nebels, denn die Deutschen hatten unter anderem auch deswegen das Lager in Auschwitz gebaut, nahm ich das Angebot des Onkels an, mit ihm zu wohnen. Er pflegte fast den ganzen Tag zu Hause zu verbringen, in der Gesellschaft seiner Bücher, oder mit dem Betrachten von Fotoalben der Familie. Viele Abende verbrachten wir gemeinsam in Gesprächen; wir versuchten dabei, die Ursachen und den Zweck des Großen Umsturzes zu erraten, auf der Suche nach dem Sinn im Sinnlosen und nach der Logik im Wahnsinn. Er war sich schon damals dessen bewusst, dass er den Keim des nahen, unabwendbares Endes in sich trug. Die schwere Krankheit, die in den modrigen und finsteren Kasematten der Festung von Komárom ihren Anfang genommen hatte, schritt langsam und im Verborgenen fort, jedoch unaufhaltsam. Er versteckte sie, solange er konnte, doch dann legten die Ärzte die endgültige Diagnose fest: Knochentuberkulose. Damals gab es noch keine Antibiotika, die Krankheit war unheilbar. Eine Zeitlang lag er im Krankenhaus, wo man ihm mit konservativen Methoden behandelte, die nur bis zu einem gewissen Grad den einzig möglichen Ausgang aufschieben konnten. Um seine Schmerzen zu lindern, verabreichte man ihm geringe Dosen Morphium. Er wurde von der Droge abhängig, die nicht nur seine Schmerzen linderte, sondern auch die immer schwereren seelischen Schmerzen wegen des Verlusts seiner Frau und seines Sohnes.
Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, mussten wir uns trennen. Onkel Stevan übersiedelte in eine kleinere Wohnung, während ich zum Studium nach Belgrad ging. Den Rest seines Lebens verbrachte er auf der Suche nach der heilsamen Droge. Seine Freunde und Bekannte versuchten, ihm zu helfen, wahrscheinlich im Glauben, auf diese Weise Buße zu tun für eigene und fremde Sünden, die sie ihm und seiner Familie angetan hatten. Er verkaufte alles Wertvolle und nach und nach all seine Bücher, die er viel mehr liebte als all den Schmuck und das Gold. Ein Roma-Mädchen kümmerte sich um ihn und pflegte ihn mit unglaublicher Hingabe und Anhänglichkeit.
Ich hielt stets Kontakt zu ihm. Anfangs wurden meine Briefe pünktlich beantwortet, doch später blieben seine Briefe immer öfter aus. „Am Tag schlafe ich“, schrieb er mir, „und die Nächte verbringe ich damit, die Schatzkammer meiner Erinnerungen zu durchwühlen.“ In seinem vorletzten Brief, der unleserlich und schwer verständlich war, stand der letzte Satz in gestochener Schrift und deutlich da: „Alles liegt hinter mir, alles ist bereits passiert, alles wurde von der Asche des Vergessens bedeckt. Nur die Nacht kommt, die unerbittliche und gespenstische, und alles wiederholt sich: die Angst vor der Einsamkeit und der Gedanke an den Tod.“ Der letzte Brief kam eine Woche nach seinem Tod. Das war ein Blatt Papier, auf dem in sauberer Schrift ein Zitat des französischen Schriftstellers und katholischen Predigers Jacques Bénigne Bossuet: „Wenn ich vor mich schaue, sehe ich, wie groß der Raum ist, in dem ich mich nicht sehe. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich, wie erschreckend die Reihe ist, in der es mich nicht mehr gibt. Wie wenig Platz nehmen wir ein im klaffenden Abgrund der Zeit.“
Erst später entdeckte ich auf der Rückseite des Briefes ein Postskriptum, das kaum zu lesen war: „Es ist doch nicht alles so schwarz. Wie auch immer sie mich drehen, mein Hintern wird immer hinten sein.“ Der unübertroffene Steve Stan blieb bis zum letzten Augenblick Steve Stan.
Er starb an einem schwülen Nachmittag im Sommer, im zweiundvierzigsten Lebensjahr. Er wurde auf dem Jüdischen Friedhof von Sombor beigesetzt, hinter dem schmalen Fluss Mostonga, unter der Šikara. Bei der Verabschiedung waren viele Leute da: eine große Zahl an Serben, einige Ungarn und sehr wenige Juden, so viele wie eben nach dem Großen Umsturz übrig geblieben waren. Das Kaddisch las Geza Hamburg, ein Taschnermeister aus Sombor, der einzige Fünfzigjährige, der aus dem Lager zurückgekehrt war, aus der Welt voller Dunkelheit und Nebel. Einer der Anwesenden bemerkte: „Statt eines Totengebets hätte er lieber einen guten Witz.“ Wäre er dabei gewesen, hätte mein Stiefvater gesagt: „Er lebte für den Scherz, er starb an einem Scherz.“ Das hätte ein Epitaph für Steve Stan sein können …
Wenn sie sich an den Rabbi Mosche ben Majmon oder Majmonides erinnern, sagen gelehrte Leute: „Mi Mosche ad Mosche lo kam ke Mosche“ – „Von Mosche zu Mosche gab es keinen Menschen wie den Mosche“. Nach dem Abschied von Onkel Stevan, der mein Verwandter, mein Freund und Lehrer war, notiere ich: Von Stevan zu Stevan gab es keinen Menschen wie den Stevan Lukacs.
DAS NEUE BLAUE HEFT
Wir können weder die Schwere der Sünde eines Menschen bestimmen, noch die Größe seiner Schuld. Ihre Spuren sind unauslöschbar und ihr Einfluss auf das Leben unvorhersehbar und unabsehbar. Wir können über keinen urteilen, wir dürfen keinem verzeihen.
Put u Birobidžan (Reise nach Birobidschan)
Übersetzt von Elvira Veselinović
-
Gemäß einer Randgestalt unter den Nachkommen der Familie Rothschild lautet deren Genesis folgendermaßen:
Als Gott den Menschen erschuf, nannte er ihn Mayer Amschel Rothschild. Dieser lebte siebzig Jahre und bekam sieben Söhne, die er in fünf europäische Metropolen schickte. Der Londoner Sohn Nathan, genannt der Goldene, finanzieller Sieger der Schlacht von Waterloo, gebar Lionel, den Financier des Suez-Kanals und britischen Parlamentarier; Lionel lebte siebzig Jahre und gebar Nathaniel, den ersten Lord unter den Rotschilds und allen sonstigen Juden, und Walter, den ruhmreichen Zoologen. Der französische Sohn des Mayer Amschel, James, ein britischer Banker in Paris, lebte fast sechsundsiebzig Jahre und gebar den im ganzen Judentum bekannten Baron Edmond, den Gründer des Fonds zum Rückkauf des palästinensischen Landes, Philanthropen und herausragenden Sammler, der viel Geld in alles Jüdische, was da im Lande Palästina kreuchte und fleuchte, investiert hat. Auch die übrigen drei Söhne von Mayer Amschel, der neapolitanische, der Frankfurter Sohn und der Wiener, Männer von hohem Kontostand und hohen Maßstäben, Industrielle, Konstrukteure, Banker, Wohltäter, gebaren allesamt würdige, fleißige und reiche Söhne und Töchter, jedoch wurden in Tagen des Übels ihre Pforten aufgebrochen, ihre Häuser geplündert und ihre Knochen zerstreut.
Für unsere Geschichte am wichtigsten ist Edmond, der besagte Kunstsammler und Liebhaber der Kunst und der Menschen, an den sich die ersten Kolonisten in Palästina um 1880 herum mit der Bitte wandten, sie finanziell zu unterstützen. Er erhörte sie und übernahm nach und nach die Sorge für alle jüdischen Siedlungen, schickte Geld, Fachleute für Landwirtschaft und Beamte, mit der Aufgabe, die Juden wieder zum Anbau von Getreide, Wein, Gemüse, Geflügel und Vieh zu bewegen. Er kaufte von den Arabern und Türken 125.000 Acker Land für sie und errichtete Siedlungen in Samaria und Galiläa. Er starb, bereits sehr betagt, im Jahre 1934. Seine dankbaren Landsleute überführten zwanzig Jahre später seine Gebeine nach Israel.
Der edle Baron nahm sich also der Aufgabe an, ein Heim für die Juden zu erwerben und das längst verlorene Land der biblischen Väter zurückzukaufen. Dies war keineswegs einfach, da der türkische Sultan entschieden gegen die jüdische Besiedelung Palästinas war. Das türkische Gewohnheitsrecht spielte den Kolonisten jedoch in die Hände: Hatte jemand erst einmal seine vier Wände errichtet und drei junge Bäume gepflanzt, würde ihn keine Staatsmacht dieser Welt mehr von dort wegbewegen, selbst wenn er das Land gesetzeswidrig erworben hatte. So wird jedes neue Tomatenbeet, jede Reihe Zwiebeln zum Schutzwall für die Heimat.
Es waren ernsthafte Streitigkeiten und Teilungen aufgeflammt unter den Juden zu Zeiten der Jahrhundertwende. Die emanzipierten, wohlhabenden Juden aus dem Westen waren der Meinung, eine Heimat müsse man sich suchen, kaufen oder sie bekommen, egal wo sie sich befand – in Uganda, unter britischem Protektorat; in Argentinien nach dem Hirsch-Plan; in der ehemaligen Hova-Monarchie auf Madagaskar; in Südwest-Australien oberhalb von Esperance, in Amazonien oder eben Palästina, sollte der Sultan die Urkunde unterzeichnen. Die Juden aus dem Osten hingegen, ständige Opfer von Pogromen, ausgeraubt und gemeuchelt, forderten ein Palästina wie es ihnen nach historischem Recht zustand und waren zu keinerlei Kompromiss bereit. Der westliche Zionismus stellte sich aus taktischen Gründen auf ihre Seite. Die Assimilationisten beider Seiten behaupteten, das Übersiedeln nach Palästina würde das Judentum in der Diaspora tödlich schwächen, die Judenfrage jedoch nicht lösen; die Hassiden in Polen liebäugelten einfach nur mit dem Zionismus, und die Reformisten würden sich selbst gar nicht für Angehörige einer besonderen Nation halten, sondern einer Glaubensgemeinschaft. Und schließlich sprechen sich die jüdischen Gewerkschaftler in Russland, nachdem sie alle miteinander verschmäht haben – die seidenen Rothschild-Landkäufer ebenso wie die zionistischen Blender, die bürgerlichen Nationalisten und die kosmopolitischen Assimilationisten – für die kulturelle Autonomie innerhalb der künftigen Gesamtrussischen sozialistischen Föderation aus, und sehen ihr künftiges Heim unter dem neugeborenen Sowjet-Stern.
Der Baron de Rothschild blieb seinem Konzept der käuflichen Geschichtsschaffung treu, aber diese verschiedenen Vorstellungen von der Judenfrage weckten in ihm zwangsläufig den Wunsch, seine Fürsorge und sein Geld in verschiedene Richtungen zu leiten. Und wie es sich für jeden wahren Sammler und Wohltäter gehörte, der beim Bezahlvorgang für die eine Verpflichtung bereits nach einer neuen suchte, hielt auch Rothschild, noch während er ein Haus für arme Verwandte in Palästina kaufte, bereits nach einem Dach über dem Kopf für die armen Nachbarn Ausschau, und dann nach einem dritten, vielleicht auch vierten kleinen Ersatzheim für die Stammesgenossen in der Zerstreuung, jedes unter einem anderen Himmel, alle verschieden aber ähnlich abgeschieden, so weit wie möglich von den Marktplätzen und Scheiterhaufen der Welt entfernt. Denn es ist nur recht und billig, dass ein jahrhundertelang zerstreutes Volk ohne Heimat zum Schluss mindestens zwei davon bekommt. In der einen bedroht, wird es Rettung in der anderen suchen; verbannt aus der zweiten, wird es in der dritten um Zuflucht bitten. In diesem Gedanken suchte der Baron die Weltkarte bereits nach geeigneten Orten ab: sumpfige, unattraktive Flussdeltas, von natürlichen Hindernissen umgebene Hochebenen, Inseln mit Steilklippen und Unterwasser-Landzungen direkt am Hafen, Dschungel-Gegenden, in denen Staatsgrenzen verschoben wurden, überquollen oder sich zurückzogen, gemeinsam mit den Schlingpflanzen und den Holzfällern. Mit der Gänsefeder in der Hand, träumerisch aber konzentriert, folgte er auf der Landkarte den Erd-, Meeres- und Luftströmen, die die Welt erschufen, abrissen und veränderten. Er dachte über die Macht nach, der sich Golf- und der Labradorstrom unterordneten; fragte sich, was die globalen Winde, die Aal- und Vogelmigrationen steuerte, die Wanderungen von Völkern, Sprachen und Geld. Er tauchte die Feder in die Tinte, strich den überflüssigen Tropfen am kristallenen Hals des Tintenfasses ab und senkte die angeschnittene Spitze an der Ostküste des Levantinischen Meeres ab. Wie abwesend ließ er zu, dass der zweite Tropfen auf das holzfreie Papier fiel und vom Küstenblau des antiken Jaffa aufgesaugt wurde, um sich dann überraschend, mit der Geste eines Künstlers, der nach langem Zögern endlich den ersten Strich zieht, von seiner Phantasie treiben zu lassen und nach Westen abzubiegen, an der afrikanischen Küste entlang, wonach er an den Felsen von Gibraltar hängenblieb, kurz am Ufer des Guadalquivir verharrte, dann nach oben entlang der Pyrenäen und entlang den Häfen der Mitte des europäischen Kontinents weiterlief; um genau in dem Moment, wo er hinunter zum schwarzen Meer fahren sollte, oder auch nicht; zum Fuße des Kaukasus und über Kleinasien die Ellipse der Diaspora genau so zu schließen wie die Erde ihren Weg um die Sonne abschloss; genau in dem Moment machte Baron de Rothschild aus einer Laune heraus einen baronesken oder einfach nur künstlerischen Schwenk, flog über das düstere, undurchsichtige Asien und bohrte die Feder außerhalb jeder Umlaufbahn in den tiefen untersten Rand Ostsibiriens.
Ein jeder Mensch fühlt sich beim Herumkritzeln auf der Landkarte wie Kolumbus, wie ein Abenteurer, Visionär und geistiger Eigentümer einer neuen Welt; der Baron Edmond war all das und noch mehr. Seine Stammesgenossen waren von Gott und dem Lauf der Geschichte über einen breiten Rand von Mittelmeer und Schwarzmeer verteilt worden, mehrfach zu Reisen über den Atlantik in beide Amerikas gezwungen worden. Nun würde der bebende Tropfen von Edmonds Tinte den semitischen Samen bis an die Enden der Welt tragen und dort neue Baumschulen gründen; sichere, so Gott will, aus denen, gestärkt durch die raue Umgebung sibirischer Rassen, ein erneuertes, erstarktes jüdisches Geschlecht erwachsen würde. Dieser Ort im Nordosten Asiens, in dem des Barons tintenverschmierter Pfeil steckengeblieben war, befand sich außerhalb der Wege und Ströme, auf denen sich bisher das Judentum bewegt und gelitten hatte, außerhalb von dessen Wünschen und Befürchtungen. Der Baron schaute durch die dichten Wimpern an den fleischigen Lidern auf bis dahin nie gesehene Flüsse Biro und Bidschan, die aus seiner Feder entsprangen und von dort zum Amur rannen. Dieser Ort war unendlich weit vom Berg Zion entfernt, zu dem sein Geist mit Dankbarkeit zurückkehrte wie in einen Luftkurort, von den inneren Landschaften, an die er alle Exponate seiner Kunstkollektion angepasst hatte, weit weg von den dunkelblauen Olivenhainen, den Zedern, den Mittelmeerpinien, den Datteln, Orangen – der erste jüdischen Sumpf seit der Sintflut. Eine Heimat würde nah-, die andere fernöstlich sein; eine historisch, die andere parahistorisch; sollte sie sich als unbewohnbar erweisen, würde sie schon zu irgendetwas gut sein: zum Vermieten, Tauschen, Verkaufen, oder als vorübergehende und zur Not auch ewige Herberge.
Der Baron hatte also bemerkt, dass sich ein weiterer Fleck seiner Tinte über die Weltkarte ergossen hatte. Dieser Tintenklecks, der später den Namen Rothschild-Fleck bekam, wurde zum Gegenstand wissenschaftlicher Neugier; jüdische Forscher lasen daraus in den kommenden Jahrzehnten wichtige Andeutungen ab. Und tatsächlich äußerte bei einer Auktion in London 1953, auf der einige weniger bekannte Exponate aus der Kollektion des Barons sowie Teile seines persönlichen Archivs versteigert werden sollten, ein uralter Mann mit dem Gesicht einer Mumie seine Zweifel bezüglich der Herkunft des kobaltblauen Flecks auf dem Atlas, indem er behauptete, Baron de Rotschild habe trotz moderner Weltanschauungen keine blaue Tinte verwendet, diese technologische Neuerung auf Anilinfarben-Basis, sondern schwarze, speziell für ihn aus einer Mischung von Eisenverbindungen und Kohle hergestellt, wie sie die alten Semiten verwendet haben, oder aber, seltener, eine wundersame Flüssigkeit aus verkohltem Tannenharz, Weinhefe und Gummi arabicum nach ägyptischem Rezept. Mit solcher Tinte soll Moses in seiner Jugend geschrieben haben, sagte der Freund des Hauses Rothschild, vielleicht hat er genau damit den Entwurf der Gebote niedergeschrieben, die er dann im entscheidenden Moment im Namen Gottes in Tontafeln ritzen sollte.
Die Biografen dieses prominenten Mitglieds der Familie Rothschild erwähnen diesen ostsibirischen Punkt und die damit verbundenen möglichen Pläne nirgendwo ausdrücklich, aber es gibt Tatsachen, die darauf hinweisen, dass bereits zu Lebzeiten des Barons, in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, zu deren Realisierung übergegangen wurde. In Ostsibirien wirkte allerdings nicht das Geld des Barons, sondern die russische Regierung. Die Planer revolutionärer Veränderungen müssen wohl während der konspirativen Lehrzeit in Europa den Gedanken des Barons auf die Spur gekommen sein, diese mit den Ideen Leo Trotzkis zu dieser Frage gekreuzt haben und schon bald nach der Proklamation der neuen Staatengemeinschaft die Möglichkeiten einer jüdischen Kolonisierung der Amur-Ebene erforscht haben. Der Bericht von der ersten Expedition ist allerdings nicht besonders ermutigend: es wird eingeräumt, dass das Gelände in den betreffenden Gebieten nicht zum Leben tauglich ist, weswegen ausführliche Vorbereitungen unerlässlich sein werden, aber es wird nicht von dem Plan abgerückt, schon 1929 den ersten jüdische Konvoi Richtung Birobidschan aufbrechen zu lassen.
Der gealterte Baron hat keinen Einfluss mehr auf den realen Lauf der Dinge, wohl aber die sowjetischen und andere Propagatoren. Ihr Ruf ist unter den Juden des Sowjetischen Russlands nicht auf das gewünschte Echo gestoßen, jedoch hat die Idee des birobidschanischen Staates in Polen, Rumänien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten viele Anhänger gefunden. Man sammelt Geld für die Kolonisierung, Kontingente von Landmaschinen aus der ganzen Welt kommen nach Moskau, um von dort aus in den Osten weiterzureisen. Mit den Maschinen werden auch Menschen abgefertigt: Nach dem Programm der Sowjetregierung sollten im Jahr 1932 bereits 18.000 Juden in die Autonome jüdische Provinz Birobidschan verbracht werden, im nächsten Jahr 31.000, aber davon kamen in diesen beiden Jahren nur ein Fünftel, und auch die, die kamen, sind nach Aussagen westlicher Zeitungen meistens wieder geflüchtet.
Die jüdische Presse verfolgte den Birobidschan-Feldzug aus der Ferne und berief sich auf die Aussagen vereinzelter Zeugen. Das für die Ansiedelung der Juden vorgesehene Territorium, berichteten diese, sei in der Tat ein furchtbarer Morast mit ungesundem Klima, kurzen feuchten Sommern und langen, regnerischen Wintern, was sogar die ukrainischen Bauern, die Vorgänger der Juden in diesem Experiment, dazu brachte, dahin zurückzukehren, woher man sie einst geholt hatte. Aber die Regierung gibt nicht auf. Kalinin unterschreibt 1934 ein Edikt über die Gründung des Autonomen jüdischen Territoriums und teilt mit, dass bereits 1937 dort 150.000 Juden wohnen werden. Ein Film aus jener Zeit, »Die Glückssucher«, zeigt die Freude der zugezogenen Neu-Birobidschaner. Der Film brachte sogar einen Teil der russischen Juden dazu, sich trotz aller bitteren Erfahrungen ins neue gelobte Land aufzumachen.
Über ihr Schicksal gibt es allerdings keine Berichte. Vereinzelt taucht in der Presse vor dem Krieg Birobidschan noch auf, aber die Birobidschaner nicht. In der Moskauer Iswestija wird im Juni 1939 anlässlich der Volkszählung angeführt, dort lebten mehr als einhunderttausend Menschen, aber gemäß einer im Westen veröffentlichten Reportage sind davon noch nicht einmal dreißigtausend Juden. Vor der deutschen Invasion fliehen Hunderttausende Juden nach Osten, nach Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan, aber nur ganz wenige reisen weiter nach Birobidschan. Sie werden auch nach dem Krieg nicht dort hinziehen, wenngleich ihre Heime in Russland, Ukraine, Weißrussland und Polen abgebrannt und ihre Verwandten ausgerottet sind. Anschließend verschwindet Birobidschan zusammen mit anderen Wörtern und Menschen aus der Verwendung in der Öffentlichkeit. Zwar wird Kalinin 1945 einem Newyorker Journalisten sagen, die sowjetische Regierung würde im Einklang mit der Verfassung das Autonome Territorium in eine jüdische Republik verwandeln, sobald darin einhunderttausend Juden lebten. Auf die Frage der Journalisten, ob es denn nicht längst so viele gäbe, antwortet der Präsidiumsvorsitzende des Obersten Sowjets, es fehlten noch ein paar. Der Journalist weiß selbstverständlich, dass es in Birobidschan zu dem Zeitpunkt höchstens zehntausend gibt, also sogar zwanzigtausend weniger als vor dem Krieg, da sehr viele gestorben oder geflohen sind. In den Jahren darauf wird das Autonome jüdische Territorium eine Zone der ethnisch neutralen Standarddeportation, ein großes KZ nach der Vision von Lawrenti Pawlowitsch Berija. Nach Stalins Tod und Berijas Liquidierung holt Malenkow die Idee der Judaisierung Birobidschans wieder aus der Schublade hervor. Allerdings ist der jiddische Birobidschaner Schtern da bereits erloschen, über Schulen gibt es keine Angaben, über die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung existieren keine Angaben. Die Moskauer Prawda führt Anfang 1954 an, bei den baldigen Wahlen im A.J.T. würden fünf Deputate gewählt, und die Birobidschanskaja Swesda kündigt heiter die Ankunft weiterer Juden aus der Ukraine, Russland und Weißrussland an …
(Die verfügbaren Handbücher bringen kein Licht ins Geheimnis. Die Enzyklopädie des Lexikographischen Verbands der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien von 1955 führt lediglich an, Birobidschan sei eine Stadt mit 38.000 Einwohnern an der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn, und man lebe dort von der Verarbeitung von Holz und Fleisch sowie der Herstellung von Ziegelsteinen. Die Jüdische Enzyklopädie von 1955/56 schätzt die jüdische Bevölkerung auf 100.000 Seelen, was die Hälfte der Bevölkerung des gesamten Territoriums darstellt. Jiddisch, seinerzeit als Amtssprache anerkannt, wurde durch das Russische verdrängt, das jiddischsprachige Theater geschlossen. Von 64 staatlichen Bauernhöfen sind 18 jüdisch. Die sowjetische Enzyklopädie von 1970 präzisiert, dass die Stadt Birobidschan, gegründet 1928 an der Stelle des Haltepunkts Tichonkaja, Zentrum der gleichnamigen Region Chabarowsk der RSFSR, 56.000 Einwohner hat, Anlagen zur Herstellung von Trikotage, Konfektion und Schuhen, zwei Theater – ein russisches uns ein jüdisches – sowie zwei Provinzblätter: den Birobidschaner Schtern, der dreimal wöchentlich auf Jiddisch in einer Auflage von 12.000 Exemplaren erscheint und Birobidschanskaja Swesda auf Russisch, fünfmal wöchentlich 19.0000 Stück. Die Encyclopedia Britannica von 1987 verfügt über die Angabe, dass in der Stadt Birobidschan 75.000 Menschen leben, und im gesamten Territorium 200.000. Die Oblast ist demzufolge hauptsächlich eben, sumpfig, von Sumpfwäldern und Weiden durchzogen, die jetzt größtenteils beackert sind. Im Norden und Nordwesten wird das Tal vom Bureja-Gebirge und dem Chingan begrenzt, die mit Fichten, Kiefern, Tannen und Lärchen bewachsen sind. Die Winter sind trocken und sehr kalt, die Sommer warm und feucht. Die Bevölkerung siedelt hauptsächlich an der Transsibirischen Eisenbahnstrecke und am Fluss Amur. Sie züchten Weizen, Roggen, Hafer, Soja, Sonnenblumen und Gemüse, im Amur fangen sie Fisch, hauptsächlich Lachs. Zusätzlich zu Baumaterialien, Schuhen und Textilwaren stellen sie Anhänger für Traktoren her.)
Die Verbindung zwischen der Familie Roth aus Novi Sad zu Birobidschan ist ähnlich mythisch wie die des Barons. Im Übrigen gilt dies auch für die Beziehung zwischen den Roths und den Rothschilds, was sich der gemeinsamen ersten Silbe des Nachnamens niederschlägt. In den Jahren zwischen den zwei Weltkriegen, als sie sich gerade auch selbst irgendwie konsolidiert hatten, verfolgten die Roths die Wege und Vorhaben der Rotschilds mit einer Art familiärer Nachgiebigkeit und Wohlwollen: Die Macht der Rotschilds jedenfalls verbarg sich in der zweiten Silbe ihres Nachnamens, dem Schild, dem roten Ladenschild, welches das Haus der Familie in Frankfurt bereits vor vier Jahrhunderten zierte, während die Novisader sich an keine ähnliche Immobilie erinnern konnten, was bedeutete, dass sie die einsilbige Farbe ihres Nachnamens einzig und allein in ihren Adern durch die Zeit tragen konnten, während sie abgenutzte rote Spuren auf dem Kopfsteinpflaster und dem Staub hinterließen. Die Leere im Stammbaum füllten die Roths mit der Geschichte von der bayrischen Stadt Rothenburg, die, wie man behauptete, ihren Namen nach dem jüdischen Blut bekommen hatte, das hier seit der Zeit des berüchtigten Rindfleisch-Massakers sowie späterer Pogrome zu Zeiten der Pest vergossen worden war. Einem entfernten Vorfahren der Roths war es angeblich gelungen, dem Pöbel zu entkommen, und um seine Spuren zu verwischen und seine Herkunft zu verschleiern, nahm er einen deutschen Namen an nach der Stadt, die ihm alles genommen hatte und machte sich mit dieser gekappten Silbe auf der Schulter auf in die weite Welt der Täschner. In dieser einsilbigen Welt konnten Roths und Rothschilds Brüder sein: alle Juden waren einer Tasche entsprungen. Der Zufall wollte es, dass ein weiteres entferntes Familienmitglied, der amerikanische zionistische Anführer Morris Rothenberg eine Rolle in der Geschichte von Birobidschan spielt. Über seine Artikel begegnete ein amerikanischer Roth, Onkel Leopold in den zwanziger Jahren den Ideen des legitimen Zionismus und danach auch des Birobidschanismus, der wie eine Häresie, wie ein falscher sozialistischer Messianismus zu jener Zeit einige Kreise des amerikanischen und deutschen Judentums erfasst hatte. So begann die imaginäre Reise der Roths nach Birobidschan über Amerika.
Leopold Roth war ein Mensch von unruhigem Herzen, mit hohen aber wechselhaften Idealen, anspruchsvollen Plänen, die er jedoch kaum je realisierte. Nachdem er eine Vielzahl an Adressen und Beschäftigungen gewechselt hatte, fand er die Lösung aller seiner Probleme schließlich in der Idee, das gelobte Land müsse ja gar nicht zwingend in Palästina und auch nicht im schillernden Manhattan sein, sondern könne auch an einem ganz anderen Ort sein, gleichermaßen entfernt sowohl von der Vergangenheit als auch von der Gegenwart und gleichermaßen erreichbar sowohl für die Erfolgreichen als auch jene, die es nicht waren, besonders Letztere. Als jüdischer Halbproletarier in Amerika war er ebenso mit dem Überleben wie mit sozialistischen Ideen beschäftigt, insbesondere mit der Frage des Absterbens des Staates. Der Staat ist nicht von Dauer, schrieb er seinem Bruder Emil nach Novi Sad, den er schon seitdem er sich als Schulabbrecher nach Amerika abgesetzt hatte nicht mehr gesehen hatte. Die Gesellschaft der Zukunft würde den kapitalistischen Apparat ausnutzen, um mit dessen Hilfe allem dem Garaus zu machen, was alt und verbraucht war, die Herrschaft wird dem Volk übertragen werden, und der Staat einfach verschwinden. Das kann man aus deinem Krämerladen vielleicht noch nicht sehen, aber von der Spitze dieses teuflischen Empire State Buildings aus ist es klar, dass die Zukunft keine Grenzen anerkennt. Birobidschan, von dem ich dir bereits schrieb, wird niemals jener Staat sein, von dem die Zionisten träumen, sondern der Brennpunkt der jüdischen Revolution, die die Welt verändern wird. Sobald ich mit meinen Geschäften hier Fuß gefasst habe, werde ich einen stattlichen Geldbeitrag für Birobidschan spenden und anschließend auch selbst dorthin aufbrechen, wenngleich Barbara sich dagegen sträubt. Ich würde mir wünschen, dass das im Frühling klappt, ich höre, dass sich eine Gruppe bereits auf die Reise vorbereitet. Ich bin ganz sicher, dass die Zionisten im Unrecht sind. Die Juden sollten nicht von Rückkehr träumen, sondern davon, wohin sie weiter ziehen sollen. In jedem Fall werde ich dich über den Stand der Dinge und meine weiteren Vorbereitungen informieren. Vielleicht erreicht dich mein nächster Brief schon mit einem Poststempel von Birobidschan. Wie geht es Vali und den Kindern? Viele Grüße an alle, es umarmt dich dein Leo. Es kam der Frühling und dann der Sommer, doch Leopold meldete sich weder aus New Jersey, wo er die letzten beiden Jahre gelebt hatte, noch aus Birobidschan. Auch Barbara, Leos Frau – oder Witwe, Gott bewahre, sollte dem Unglückseligen auf dem Weg ins Gelobte Land etwas zugestoßen sein – reagierte nicht auf Emils besorgte Briefe, ebensowenig die Vermieter, sollte Barbara mit den Kindern ihm gefolgt sein. Es kamen auch keine Briefe zurück, was der Fall sein sollte, wenn die Wohnungsgeber, irgendwelche Juden aus Minsk, sich ebenso nach Birobidschan aufgemacht hätten oder das Wohnhaus abgerissen worden war, was in Amerika, einem Land ohne Grundstein, häufig der Fall war. Drei Jahre zogen in unheilvoller Stille dahin, ohne dass ein einziges Lebenszeichen von irgendeinem Kontinent zu vernehmen war, und das reichte aus, um im Novisader Zweig der Familie Roth die Vorstellung von einem giftigen Apfel der Sorte “Birobidschan” reifen zu lassen, der die Plaudertaschen und Phantasten tötete, die nach all jenem gierten, was in der Luft hing. Als sich Leopold endlich, gegen Ende der Großen Krise, von einer neuen Adresse aus einer neuen Stadt in einem neuen amerikanischen Bundesstaat meldete und kurz von seiner neuen Arbeit und dem neuen Familienmitglied berichtete, platzte die Birobidschan-Blase und befreite eine ziemliche Menge an unterdrückter Angst, Ärger, Humor und fieberhafter Hoffnung. Birobidschan wurde eine hitzige Metapher, durchwirkte die Redensarten, die Sprichwörter – sowohl scherzhafte als auch bittere – die Flüche und Ausrufe, Belehrungen an Kinder und Flattergeister; ein asiatischer Name, ausgesprochen mit ungarischem Akzent, hatte sich niedergelassen wie ein Straßenköter bei einem selbstgewählten Herrchen. Der Händler Emil Roth pflegte seinem Sohn zu sagen: Ich kaufe dir ein Auto, wenn ich die Bank in Birobidschan ausgeraubt habe. Zur ältesten Tochter: Du heiratest, wenn der Gouverneur von Birobidschan um deine Hand anhält. Den gelben Davidsstern nannte er den Birobischan-Stern, und vor der Deportation 1944 verabschiedete er sich von seinem Freund Sava Jakšić mit den Worten – Wir sehen uns in Birobidschan. Nach dem unerwarteten Tod des amerikanischen Verwandten, mit dem alles begonnen hatte, wurde Birobidschan als dessen Nachlass unter den Familienmitgliedern verteilt und blieb fortan noch zwei Generationen im Wortschatz. Emils Sohn Stevan, Zahnarzt mit Leib und Seele, fest wie eine Plombe und gegen jede Sentimentalität gefeit, konnte nicht umhin, gegen Ende der Hochzeitsnacht seiner Auserwählten ganz gerührt etwas vom untergehenden Mond und der aufgehenden Sonne im fernen Birobidschan zuzuflüstern. Für seine junge Gattin Olga blieb dieser exotische geographische Begriff lange Zeit die Verkörperung von Stevans erstem und leider auch letztem lyrischen Auftritt. Sie bemühte sich, mit dem Lichtstrahl dieser Empfindsamkeit ihre Ehe zu erhellen. Sie wehrte sich gegen die Erklärung, Birobidschan sei lediglich ein von wenigen Menschen und vielen Mücken bewohnter Sumpf. Sie glaubte dass sich, wie in jeder überzeugenden Geschichte, hinter dem Trugbild aus Sumpfgasen und fauligen Baracken ein heller, steinerner Liebeshüter verbarg, der birobidschanische Taj Mahal.
Man kann sagen, dass Olga, wenngleich eine geborene Kraus, die einzige Fortsetzung der birobidschanischen Ader der Familie Roth war. Ihre erste jugendliche Unruhe hatte sie auf Palästina fokussiert und sich, nachdem sie Mitglied von Hashomer Hatzair geworden war, darauf vorbereitet, nach dem Abitur mit einer Gruppe Gleichaltriger dorthin zu gehen, aber durch die Verlobung mit Stevan Roth wurde dieses Vorhaben auf ein andermal verschoben. Nach der Rückkehr aus dem KZ schwor sie sich, den Rest ihres Lebens in ihrer eigenen Küche und ihrem Esszimmer zu verbringen, aber schon auf den ersten Ruf Israels hin war sie bereit, Küche und Esszimmer in eine Truhe zu packen und sich auf die Reise zu machen. Die erste, zweite und dritte Alija waren schon vorbei, alle, die es vorhatten, gingen nach Israel; Stevan erklärte schließlich, er würde seinen Zahnarztbohrer nicht hier zurücklassen, um dort mit einer Picke Steine zu hacken, er würde definitiv nirgendwo hingehen, aber schon bald, im Herbst 1952, packte auch er seine Sachen und ging mit seiner Assistentin – für immer. Damit war ein Strich unter Olgas Verluste gezogen: fast alle ihre Liebsten waren tot, ihr Herz verwüstet. Wären wir doch irgendwo hingegangen, zur Not auch ins verdammte Birobidschan! kreischte sie, als Stevan ihr sagte, er habe hier nichts mehr verloren. Wären wir doch wenigstens ins verdammte Birobidschan gegangen, wimmerte sie noch lange, während sie mit einer Binde über der migränegeplagten Stirn durchs Zimmer torkelte, und ihr vierzehnjähriger Sohn Nenad an der Tür stand, als Hüter des Ausgangs nach Birobidschan, und aufpasste, dass seine Mutter nicht zufällig durchkam. Ins verdammte Birobischan, ins verdammte Birobidschan, jammerte sie noch tagelang, und ihr Sohn erstarrte jedes Mal angesichts einer ungesunden Leidenschaft, die sich durch Schichten von Nachthemden, Schlafröcken und damastener Kopfbinden aus den finsteren Tiefen ihres Ungemachs einen Weg an die Oberfläche bahnte.
Nenad Roth verlegte das ‘Birobidschan’ genannte Familiengut rechtzeitig in die Prärien des Wilden Westens und besiedelte es mit Komantschen, Schoschonen und Birobidschanern. Endlose Rinderherden weideten auf dem harten, scharfen Gras, Pferdeherden flogen pfeilschnell über die Ränder der Hochebene und verschwanden hinterm Horizont. Eines Abends, vierzig Jahre später, stürmten sie im Galopp das Leben des Nenad Roth, jetzt ein Novisader Anwalt mittleren Alters. Die Vorahnung von Gefahr, von allumfassendem Unglück, brachte die Jungenträume in Bewegung und zerstreute sie. Aus dem fernen Birobidschan wehte ein globaler Schauder herbei und ließ die Wirbelsäule gefrieren. Der Birobidschaner Galopp hallte in den Knochen wider.
Bestimmte Ausprägungen des Birobidschan-Syndroms tauchten fast gleichzeitig auch bei Dina Roth auf, Nenads Tochter aus erster Ehe, und besonders hart und schmerzhaft bei deren Mann Miloš Bojić. Diese würden die Erkrankung auf ihre Kinder übertragen, sollten sie welche bekommen, und alle ihre Nachkommen und die Nachkommen der Nachkommen würden ihr eigenes Birobidschan haben, diesen ständigen Brennpunkt und Zufluchtsort, der sich vor der Welt versteckt und nur beiläufig oder im Traum erwähnt wird. Es ist schwer vorauszusagen, was Birobidschan in Zukunft bedeuten wird, aber in Zeiten großer Erschütterungen, wenn ganze Welten in die Vergangenheit abstürzen, existiert auch nichts anderes. Die europäischen Zentren London, Paris, Neapel, Frankfurt und Wien sind nur noch Telegrafenstationen, Informationsknotenpunkte: alle Wege führen nach Birobidschan. Im Laufe des Jahrtausends ist der Mittelpunkt der Welt von Ort zu Ort gewandert: Ur, Memphis, Babylon, Jerusalem, Athen, Alexandria, Rom, Konstantinopel, Mekka, Moskau, Berlin, New York, Tokio: in dem Moment, wo diese Geschichte beginnt, heißt der Mittelpunkt des Trichters der Welt, des globalen Vergessens – Birobidschan. Am Belgrader Flughafen sind alle Flüge abgesagt. Der Bildschirm im Wartebereich spuckte eines Nachts einen Bestimmungsort aus, der in keinem Systemspeicher existiert: Birobidschan. Durch das elektronische Flackern des einsamen Wortes rief eine metallische Stimme die Reisenden zum Ausgang B2.
Unzählige Birobidschans! Das ist hoffnungslos!, sagte Miloš Bojić, drehte sich um und verließ das Flughafengebäude.
-
Am Abend des dritten und letzten Tages ihres Belgrad-Aufenthaltes war Bertha Pappenheim bei der Familie des Kaufmanns Josef Gutman in der Ulica majke Jevrosime zum Abendessen eingeladen. Die nachmittägliche Versammlung der Föderation Belgrader Frauenvereine hatte sich in die Länge gezogen, und die aus Frankfurt angereiste Bertha wollte die Gelegenheit nutzen, sich energischer für die Abschaffung einer schandhaften, jämmerlichen und dummen Bestimmung einzusetzen, gemäß derer die Prostituierten aus den Pensions-Bordellen wie Gefangene behandelt wurden, ohne Recht auf Bewegungsfreiheit. Dies hatte wiederum dazu geführt, dass die Gans ein wenig durchgebratener war, als Frau Gutman gewollt hatte.
Die Stunde des Wartens kam den Familienmitgliedern länger vor, als sie eigentlich war, nicht, weil sie besonders empfindlich bezüglich Pünktlichkeit und anderer europäischer Manieren waren, sondern weil zu dieser Zeit der scharfen und unangenehmen Abgeschnittenheit von Österreich-Ungarn und Europa, der Kälte und Gefahr, die von Save und Donau in Richtung Österreich-Ungarn wehten, für die serbischen Juden jede Berührung mit europäischen Juden – selbst wenn sie Aschkenasim waren – ein Fünkchen Hoffnung und Erwartung barg; Ermutigung, dass die Dinge schon nicht schief laufen würden, jedenfalls nicht mehr, als die innerjüdischen Unterschiede verlangten.
So gingen auch der Hausherr Josef und sein Bruder Solomon, sowie ihr entfernter Verwandter Haim Azriel als erfolgreicher Leder- und Wachshändler, als Aktionäre der Exportbank, in der Haim Mitglied des Aufsichtsrats war, davon aus, dass eine Frau mittleren Alters, die sich allein auf den Weg durch die Balkanländer gemacht hatte, mit dem (angeblichen?) Ziel, Jagd auf Menschenhändler zu machen, einen ausreichend mächtigen Beschützer und Finanzierer haben musste, eine starke jüdische Gemeinde in Frankfurt und Wien, und dass ihre Anwesenheit in Belgrad dazu genutzt werden konnte, die während der Zollkrise gerissenen Fäden wieder zusammenzubinden.
»Wenn der Wiener Maximilian Kraus serbischen Kaufleuten auch während der Krise Kredite geben konnte«, sagte Josef, während er seine Taschenuhr in der Hand drehte wie einen Kompass, »dann gibt es keinen Grund für die neuen Quellen jüdischen Kapitals, sich gegenüber ihren balkanischen Landsleuten nicht zu öffnen, jetzt, da die Krise beendet ist.«
Josefs Gattin empfing Fräulein Pappenheim voller Bewunderung für deren Mission und Mut, sich auf die riskante Reise durch den Balkan einzulassen, sorgte sich jedoch gleichzeitig, diese weitgereiste Jüdin fragwürdiger Religiosität könne an ihrem Esstisch alle möglichen Geschichten über jüdische Bordelle und uneheliche Kinder auftischen.
Als Fräulein Pappenheim gegen halb neun in Begleitung von Doktor Savić endlich erschien, mit energischen Bewegungen und lebhaftem Blick, die ihre Müdigkeit verbargen, und sich sofort allen Hausbewohnern gegenüber öffnete, ahnte Flora sofort, dass sie die Art Person war, in deren Gegenwart sich stets bahnbrechende Dinge ereigneten, die Bewegung, Veränderung und Ereignisse einfach befeuerten, die Dinge aufforderten, sich zu formen, zu ereignen und sich im wahren Licht zu zeigen, und deshalb oft mit Misstrauen und Unbehagen empfangen wurden, mit Beklommenheit, Ablehnung und oft auch mit zu hohen Erwartungen. Ohnehin war der Moment ein solcher; derart überspannt, dass sogar die Anwesenheit einer weniger wichtigen Person oder ein belangloses Ereignis den Vorhang hätte beiseite ziehen können, der den wahren Zustand, die wahren Gefühle verbarg.
»Belgrad ist übrigens eine wunderbare Stadt«, sagt Bertha Pappenheim, »ich fühle mich hier äußerst wohl«, und während sie zum dritten Mal slatko und Wasser nimmt – Frau Gutman hatte ihr erklärt, das sei ein einheimischer serbischer Brauch – und große, bernsteinfarbene Kirschen aus der Kristallschale zum Mund führt, spürt sie, das der Moment gekommen ist, den Gastgebern den Gefallen zu tun, ihre Stadt zu loben. Sie ist erst den dritten Tag in Belgrad und Serbien, morgen muss sie leider schon weiter Richtung Süden, nach Sofia, aber was sie gesehen hat, hat sie weitgehend ermutigt, und sie wird alles tun, um zumindest ihre Mitarbeiterinnen und Freundinnen in Frankfurt, und nach Möglichkeit auch die breitere deutsche Öffentlichkeit, zu überzeugen, dass jene, die Europa als »Nasenabschneider« bezeichnete, eigentlich ein intelligentes und liberales Völkchen seien, zukunftsoffen und Europa sehr zugewandt, wenngleich in gewissen Dingen auch etwas anachronistisch. Dennoch, das Kopfsteinpflaster sei furchtbar und man könne nur mit Mühe darauf gehen, wovor man sie in Wien gewarnt habe, aber sie gehe dennoch lieber zu Fuß, als übel durchgeschaukelt zu werden. Ohnehin könne man eine Stadt nicht kennenlernen, ohne sich die Fußsohlen abzuscheuern. »Aber Kopfsteinpflaster bleibt Kopfsteinpflaster.«
»Zum Glück ist die Krise beendet und es gibt keinen Grund, warum die Wege des Kapitals sich nicht wieder zu uns nach Belgrad ergießen sollten«, sagte Josef Gutman, »im Übrigen braucht man nach dem neuen Abkommen ja noch nicht mal mehr einen Reisepass.«
»O ja«, nimmt Fräulein Pappenheim an und legt das Löffelchen zurück in die Schale mit Wasser, »das wird den Menschenhandel noch um einiges leichter machen«.
Die Besucherin machte keinen Hehl daraus, dass sie den Ereignissen sozusagen entgegenlief. Andernfalls hätte sie niemals so viele Dinge in zwei-drei Tage und deren Beschreibung in zehn Minuten pressen können. In der kurzen Zeit, bevor sie sich zu Tisch begeben hatten, hatte sie, ohne viele Worte über die Gründe und Motive für ihre Reisen zu verschwenden – als würde sie bereits eingeweihte Mitarbeiter informieren – erzählt, wo sie in Belgrad überall war, wen sie alles getroffen hatte und mit welchem Ergebnis. Direkt am ersten Tag hatte sie den österreichisch-ungarischen Herrn Konsul besucht, in dessen Büro seit November ein sehr wichtiges Memorandum zum Menschenhandel hing, und anschließend auch den deutschen Konsul Doktor Sch., der, das musste man zugeben, weitaus gebildeter und freilich kompetenter war als sein Wiener Kollege. Er hatte sie auf den Polizeioberst (Chef de Sȗreté) verwiesen, der acht Jahre beim Studium in Frankfurt am Main verbracht hatte und nun bemüht war, der Besucherin bestimmte Daten über die Prostitution in Belgrad und Serbien zu beschaffen. Außerdem hatte sie mit dem überaus liebenswürdigen Doktor Savić – hier verneigte sich Fräulein Pappenheim höflich vor ihrem Begleiter – und einem Polizeibeamten das jüdische Viertel nahe dem Donauufer besucht und dort fünf Freudenhäuser besichtigt, die zugegebenermaßen neu gebaut waren und wie sehr ertragreiche Objekte wirkten. »Es ist interessant«, sagte sie, »dass die meisten Freudenmädchen Ungarinnen sind, Jüdinnen gibt es nur sehr wenige. In Budapest und Galizien ist das leider ein wenig anders.«
Sie referierte den Gutmans gegenüber, als spräche sie auf einem Kongress, über Tatsachen, die diese angeblich nicht wussten. Doch über die Zahl von Prostituierten gab es ohnehin keinen Konsens. Der Polizeichef behauptete, es gäbe um die fünfhundert, Doktor Savić hingegen, es wären dreitausend.
Sie zählte ihre Besuche bei zahlreichen angesehenen und einflussreichen Damen auf, besonders bei der Gattin eines angesehenen Oberst, die sie zur Besichtigung eines schönen Kinderheims eingeladen hatte und ihr alles über den Frauenverein erzählte, den vor 35 Jahren Königin Natalija gegründet hatte und der sowohl ein Altenheim betrieb als auch eine Frauenzeitung herausgab. Fräulein Pappenheim hatte natürlich auch noch andere Leute getroffen, sie hatte eine christliche Familie kennengelernt, den einstigen Bürgermeister, Minister und Professor, an dessen Namen sie sich jetzt nicht erinnern konnte; doch um so lebendiger war ihre Erinnerung an das süße Rosengelee, das ihr in dessen Hause serviert worden war. Sie hatte freilich auch eine Sephardenfamilie besucht und viele neue Dinge gelernt, da sie zu ihrer Schande nichts über die Sepharden wusste, somit auch nicht, dass es in einer so angenehmen Stadt wie Belgrad eine strenge Trennung zwischen Sephardim und Aschkenasim gab, ja eine richtige Feindschaft, einschließlich der Streitigkeiten um die neue Synagoge, ansonsten ein schönes und harmonisches Bauwerk. Sie beschrieb kurz ihren Halbtagsausflug nach Pančevo, wo sie nach vorheriger telegrafischer Ankündigung des Konsuls beim Hauptmann der Grenzpolizei über die Frage des Menschenhandels informiert worden war. Leider traf sie den Hauptmann selbst nicht an, sein Assistent jedoch informierte sie, dass von den dreihundert Mädchen, die auf der Suche nach Arbeit aus Rumänien nach Belgrad gekommen waren, hinter dem Grenzort Torontálálmas fünfzig bis sechzig spurlos verschwunden waren.
»In jedem Fall«, sagte sie, »muss der Verein zum Schutz der Frauensicherheit (Secours féminin) aus Frankfurt Kontakt zu den zuständigen Behörden in Budapest aufnehmen, denn dies ist eine Angelegenheit des Nationalkomitees in Ungarn, in dessen Prärogative sich der Frankfurter Verein nicht einmischen darf.«
Auf der Rückkehr über Zemun gelang es ihr, den sehr entgegenkommenden Beamten der Hafenbehörde davon zu überzeugen, wie wichtig es war, einen Agenten für die Aufdeckung von Menschenhandel zu engagieren. Um drei Uhr nachmittags war sie bereits in Belgrad, todmüde, doch konnte sie den Ausführungen auf dem Frauenkongress noch lauschen und sich am Ende auch selbst zu Wort melden, mit einem mittelbaren Appell an die serbische Regierung, die veraltete, dumme Bestimmung abzuschaffen, durch die der Nachwuchs in den Freudenhäusern wie Gefangene behandelt wurde. »Ich erzählte ihnen vom Fall einer zwanzigjährigen Frau, die schon seit zwei Jahren keine Sonne mehr gesehen hatte.«
»Jedes Gespräch über eine Frau«, sagte Haim Azriel auf Französisch, durchaus bewusst, dass neben der Besucherin auch Flora diese Sprache verstand, »sollte mit dem Tribut und der Verneigung vor einem Menschen begonnen werden, einem tragischen Genie, dessen Werk, unkonventionell, kompromisslos und auf eine unwiderstehliche Weise finster, die Geister in Wien und einigen anderen europäischen Städten aufgewühlt hat, und der sich in seinem vierundzwanzigsten Lebensjahr (so alt werde auch ich dieser Tage) das Leben genommen hat, da er keine Möglichkeit sah, mit der Frau in sich klarzukommen, noch mit den Frauen außerhalb von sich; obendrein wusste er als umgetaufter Jude nicht, was er mit dem Juden in sich noch mit den Juden an sich anfangen sollte und sah keine Lösung, keinen Ausgang der »Judenfrage«. Fräulein Pappenheim hat den unseligen genialen Landsmann Otto Weininger vielleicht kennengelernt, aber jedenfalls gelesen, dessen Werk so maßlos wie kompromisslos ist, auf eine unwiderstehliche Weise finster. Wenn man dessen scharfe und schwer in Frage zu stellende Urteile über Frauen im Sinn hat, ahnt Fräulein Pappenheim wahrscheinlich auch selbst am Grunde ihres Herzens, wie vergeblich und vielleicht auch nutzlos ihre Mühen bezüglich der gefallenen Frauen sind. Er selbst wisse, dass die Menschenhändler, denen Fräulein Pappenheim vielleicht das Handwerk legen will, womöglich eine sehr nützliche Arbeit tun. Als die Engländer vor mehreren Jahrzehnten in dem Wunsch, ihr Land von Sträflingen zu befreien, diese nach Australien brachten, träumten sie noch nicht einmal davon, dass sie dort gerade eine neue Welt gründeten. Vielleicht ist jedes Bordell oder jeder Harem der Same eines neuen Kontinents.
»Und auch ihre Schützlinge, die Frauen im Bordell, können ihre Händler kaum erwarten, sie eilen deren Netzen geradezu entgegen. Wahrscheinlich haben sie schon einen Schiffsfahrschein für irgendein neues Australien.«
»Auf diese Weise verschwinden also die Frauen«, sagte Fräulein Pappenheim lächelnd.
Frau Gutman versteht nicht, was der junge Azriel sagt. Mit dem Blick bittet sie Doktor Savić, es ihr zu übersetzen. Doktor Savić übersetzte für die Hausherren stets rücksichtsvoll, behutsam und selektiv, doch das französische Wort »Bordell« war von internationalem Gewicht, und die Dame des Hauses senkte den Blick immer tiefer. Durch eine übergeordnete weibliche Intuition weiß sie, was ihre Tochter vielleicht nicht ahnen kann: dass dieser plötzliche, aberwitzige Hass, die Intoleranz und Verachtung ihres zukünftigen Schwiegersohns gegenüber gefallenen Frauen – über die sie selbst in der Tat auch eine ganz bestimmte Meinung hatte – seine Wurzeln woanders hat, sie begreift, dass ihr potentieller Schwiegersohn seine eigene Schiffsfahrkarte in der Hand hält. Wie infolge seiner heiseren Worte, ausgesprochen durch den Qualm einer Zigarette (die er sehr unanständig vor dem Ende des Abendessens angezündet hatte), durch die silberne Zigarettenspitze wie durch einen winzigen Magen, die Welt ihrer Tochter und ihre eigene zum Einsturz gebracht wurde. Obwohl sie kaum Französisch kann, zweifelt Flora nicht, dass der plötzliche Zynismus und die Feindschaft in Haims Haltung insbesondere ihr galten. Zuerst wirkte es, als scherzte Haim, als wollte er nur die Besucherin verwirren und sich mit Übertreibungen und Abstoßung irgendwie ihren Übertreibungen und ihrem brennenden Aktivismus entgegensetzen und so Flora einen Stich versetzen, die vielleicht bis jetzt einfach verschlossen und schamhaft war und ihm nicht klar genug gezeigt hatte, wie sehr ihr trotz aller elterlichen Warnungen an ihm gelegen war.
Doktor Savić würde gern die ganze Sache wieder in den Rahmen der medizinischen Wissenschaft und Praxis zurückversetzen, doch nach einem halben Tag mit Frauen-Aktivistinnen und zwei Gläsern Wein hat er dazu weder Kraft noch Lust, und es täte ihm auch leid, Haims Breugelhafte Phantasiebilder in die Flasche zurückzuweisen, mit der Messerklinge den qualvollen Erguss von Haims verborgenen Neigungen und Obsessionen aufzuhalten, die Flora nun vielleicht definitiv von ihm trennen würden, ihr zeigen, dass sie von diesem finsteren Manne nichts zu erwarten hatte, weder Liebe noch Respekt, nichts außer einer wankelmütigen Leidenschaft voller Gegensätze, explosiver Intoleranz und Gewissensbissen. Und deshalb hatte Doktor Savić keine Wahl, außer Öl ins Feuer zu gießen, um das, was sich als Emotion, Laune und fixe Idee ergossen hatte, mit einer wissenschaftlichen Erklärung und Unterstützung zu untermauern, und das, was die medizinische Seite der Dinge sein sollte, in eine Fortsetzung und Unterstützung der Fantasie zu verwandeln. Im Hinblick auf seine dichterische Natur, in der er Trost und ästhetische Wiedergutmachung für die emotionale Wüste der Einsamkeit, den Verlust und all die widerlichen Anblicke suchte, die ihn täglich bedrückten, fuhr er mit diesem Spiel fort, ohne Gewissensbisse; wobei er Unterstützung in seine Sinns für Humor und seiner lange unterdrückten Natur eines Träumers und Dichters fand, die seinen Pragmatismus kontrollierten und die Arbeit irgendwie erträglich machten.
War es Haim Azriel, der, nachdem er seine Gabel mit einem Stück Gänsefleisch abgelegt hatte, die Besucherin anschaute, Flora mit dem Blick streifte und sagte: »All diesen Abschaum sollte man auf eine einsame Insel voller Frösche verbannen«? – und war es Flora selbst, die gegen Ende des Abendessens, nachdem sie ein Glas Wein zu schnell heruntergestürzt hatte, enttäuscht und völlig bewusst, dass sich Haim unwiederbringlich von ihr entfernt hatte, die Idee von einem weiblichen Kontinent aussprach, einem gelobten Land, in dem sie Rettung vor männlichem Zynismus und Gewalt finden würden; und von einer Frau, einer starken, unwiderstehlichen Figur mit Sendungsbewusstsein, dem weiblichen Messias, einer Messianin, die ihre Leidensgenossinnen gemäß der Geschichte aufrufen wird?
-
Ende April 1953 schrieb Sara Alkalaj ihrer Schulfreundin Olga Roth Folgendes:
»Meine liebe Olga!
Ich bin glücklich, dass du wieder zu unserer Gemeinde gehst. Tsvi und ich waren auf der Feierlichkeit im Märtyrerwald und haben fünf junge Bäumchen gepflanzt. Aus Jerusalem hat sich eine Buskolonne auf den Weg gemacht, es kamen Freunde aus Haifa, Nahariya und Bassa. Wir waren etwa fünfhundert Jugoslawen, die sich ansonsten selten sehen, als wären wir auf … Aus Belgrad kam Isak Samokovlija. Er redete schön, ich weinte hässlich: »Ein Wald, der lebt und atmet, wächst und blüht, stellt einen Sieg des Lebens über den Tod, des Lichts über das Dunkel dar.« Es sprachen auch noch andere, und als Rabbi Alatarac den Kaddisch sprach, mussten alle weinen. Später gab mir Tsvi einen Kiefernsetzling in die Hand, er nahm sich vier und nahm mich mit zum Hang, wo bereits Löcher ausgehoben waren. Ich zählte die ganze Zeit nach, wie viele Setzlinge ich pflanzen musste, wenn ich meine Familie sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits mitrechnete, aber ich irrte mich ständig, die Sonne hatte mich benommen gemacht, mein Gehirn hatte aufgehört zu funktionieren und ich kehrte ständig an den Anfang zurück. Ich weinte, ich konnte gar nicht mehr aufhören; am Ende, als wir alle unsere Bäumchen gepflanzt hatten, standen statt fünf schwarzen Löchern fünf Bäumchen vor mir. Ich fragte mich, wer so viele Bäumchen pflanzen sollte.
Es freut mich, meine liebe Olga, dass du die Kraft gefunden hast, diese großartige Aktion zu unterstützen. Ansonsten geht es uns gut; wie du siehst, schreibe ich aus Jerusalem. Wr haben das Häuschen in Yasur verkauft und sind hierher gekommen. Tsvi arbeitet bei der Post. Deine Schwester Ila schrieb mir, du und Pišta, ihr hättet euch getrennt. Ich kann das nicht glauben. Kommt doch her und versucht es noch einmal von vorn.«
Zwei Monate vor dem Ereignis, das Dina Alkalaj beschrieb, am Tag an dem der Beginn des Pflanzens von Setzlingen im jugoslawischen Teil des Märtyrerwaldes verkündet wurde, forderte der Verband jüdischer Gemeinden seine Mitglieder auf, sich der Aktion anzuschließen, also 300 Dinar oder ein israelisches Pfund pro Bäumchen einzuzahlen, für jeden Familienangehörigen, der im Krieg umgekommen war und dem der Kiefernsetzling gewidmet sein sollte. Das erwies sich als schwierig, da einige Tausend verbliebener jugoslawischen Juden für 60.000 Setzlinge zahlen mussten. Die Einzahlungen wurden bei der jüdischen Gemeinde gemacht. Ein Teil der Frauen hatte sich bereit erklärt, diejenigen zu Hause aufzusuchen, die von sich aus noch nicht reagiert hatten, Olga Roth war auch unter ihnen. Mit Quittungsblock in der Tasche und ihrem Sohn als Verstärkung machte sie sich auf zu den eher unangenehmen Hausbesuchen. Es bedurfte gewisser Ermutigung und Überredungskünste, besonders bei den Alten oder Kranken; Geizigen oder Selbstsüchtigen; die alte Steinitzen zum Beispiel lebte vom Sockenstopfen und einer kleinen Rente und hätte als einzige Überlebende für etwa Dreißig Getötete zahlen müssen. »Für wen denn?«, fragte sie. Der schwerhörige Sonnenfeld wollte nichts von irgendwelchen Bäumen wissen. »Ich kann nicht hören«, brüllte er. Sein älterer Sohn war im Sommer 1941 in Jajinci erhängt worden, die Schuld für diesen Tod teilte mit den menschlichen Übeltätern jeder Baum, ob jung oder alt, lebendig oder als Laternenmast. Mirko Kohn fiel ein, dass für seine Verwandten längst andere bezahlt hatten. Für die Eltern war es der Bruder in Rijeka; für die Schwester und ihre Kinder der Schwager in Daruvar. Er hatte weder in Rijeka noch Daruvar lebende Verwandte. Magda Roth erklärte in der Gemeinde, die ganze Aktion sei eigentlich ein Missbrauch des menschlichen Glaubens an die Macht der Symbole, natürlich auch nur eine weitere Bestätigung jüdischer Spitzfindigkeit: wie schafft man es, Hektar um Hektar besten Nadelwalds zu pflanzen, ohne dass dies den Staat Israel irgendetwas kostet, und dass die Spender dabei sogar noch überglücklich sind, weil ihnen Gelegenheit gegeben wurde, für ihr Leben zu zahlen.
Alle zehn bis vierzehn Tage brachte Olga die neuesten Zahlungsnachweise nach Hause, zuerst aus Novi Sad und dann auch aus anderen Städten. Als Ende April ein Brief von Dina Alkalaj aus Jerusalem kam, über den Beginn der Feierlichkeiten für das Pflanzen von Setzlingen auf den Judäischen Höhen, verfügten wir in unserem Haus bereits über die Angaben, dass in Belgrad 1371 Juden für 254 Bäumchen 76.400 Dinar bezahlt hatten, was im Vergleich ein wesentlich schlechteres Ergebnis war. Dies konnte heißen, dass man in Novi Sad ein höheres Maß an Pflichtgefühl und Pietät gegenüber den Toten hatte, oder einfach nur, dass man dort mehr Verpflichtungen gegenüber einem einzelnen Toten empfand. Es war auch nicht auszuschließen, dass die Aktion in Novi Sad schlichtweg besser organisiert war und dank Volontären wie Olga Roth das Einsammeln des Geldes nicht dem Zufall, der Unsicherheit, den Gewissensbissen oder der seelischen Instabilität der Einzelnen überlassen worden war. Mancherorts, beispielsweise in Bačka Palanka, entsprach die Zahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinde ungefähr der Zahl der Einzahlungen, während in Bjelovar fünfzehn Überlebende für insgesamt 156 Bäumchen zeichneten und bis April 1954 sogar für 658. Zu den relativ erfolgreichen Gemeinden zählten überdies Čakovec, Vinkovci, Donji Miholjac, Karlovac, Slavonski Brod, Tuzla und Daruvar. Woche um Woche tauchten im Heft neue Städte auf, deren Reihenfolge in einer imaginären Tabelle wechselte: im Frühjahr führte Belgrad in der absoluten Bäumchenmenge, im Laufe des Jahres wurde es von Zagreb und Sarajevo überholt. Novi Sad schlug sich ganz gut und war den größten Städten dicht auf den Fersen, bis es im November 1954 plötzlich nachließ, um dann nur ziemlich mittelmäßig abzuschneiden. Bjelovar hielt bis zum Schluss das beste relative Resultat, die kleine weiße Stadt hatte sich selbst im Vergleich zum großen Belgrad hundertfach übertroffen. Olga und Nenad hatten sich völlig in die Zeilen und Spalten vertieft, die sich über unserem Esstisch ausbreiteten und wuchsen wie ein lebendiger Wald, wie ein Schlachtplan.
Als das Ende der Aktion verkündet wurde, war ich fast sechzehn und fühlte mich ermüdet durch das ständige Zählen und Vergleichen, alt geworden über dieser endlosen Hausaufgabe, einer vertrackten Algebra-Operation mit einer ständig und bis ins Unendliche wachsenden Zahl an Unbekannten. Lange konnte ich mich von den Zahlen nicht befreien, obwohl sie mich zuvor nicht interessiert hatten, der Wald wuchs auch nach Abschluss aller Einzahlungen beständig an, ging mit Olga Roth und den anderen Frauen von Tür zu Tür, gewann, eroberte, führte immer neue und neue Setzlinge davon. Du wolltest, dass ich dich bei diesen Hausbesuchen begleite – mir ist es nicht entgangen, dass meine Anwesenheit einen positiven Effekt hatte. Sie sollte bedeuten: Hier, liebe Freunde oder Freundinnen, so würde euer (dein) Sohn oder Enkel oder Neffe jetzt aussehen, hätte er überlebt, also mach eine Einzahlung für ein Bäumchen für ihn und er wird weiter wachsen. Ich war die lebendige Garantie, dass das investierte Geld für die Rückkehr der Verlorenen sorgen würde, für 300 Dinar bekam man ein Leben, das der Nächsten oder das eigene, ich war ein Muster der erreichbaren Unsterblichkeit, und dazu hob ich Ansehen und Preis meiner Mutter. Meine Anwesenheit schien zu sagen: habt Vertrauen zu der Frau, der es gelungen ist, ihren einen Sohn zu retten; was ihr von ihr kauft, ist nicht nur ein Andenken, eine Täuschung, sondern das Leben selbst. Ich muss wohl darin auch ein eigenes Interesse oder zumindest Bestätigung gesehen haben, ein stärkeres Empfinden für die Welt und somit auch Wichtigkeit. Ich hatte selbst eingewilligt, dich zu begleiten auf diesen Besuchen voller Stöhnen, Jammern, Zögern, eingerahmter Fotografien, Träumereien, Erkundigungen nach der Lebensdauer mediterraner Nadelbäume und der Ewigkeit und göttlichen Herkunft judäischer Gebirge, die von nun an bis in Ewigkeit die Erinnerung, die ihnen durch diese kleine Operation an einen regnerischen April- oder Junimorgen in Novi Sad eingepflanzt wurde, bewahren würden. Zugegeben, manchmal ärgerte mich der Geiz, Altersstarrsinn oder das Misstrauen Einzelner. Mirko Kohn hatte, bevor er endlich dem Schicksal für das eigene Leben bezahlte und seine 300 Dinar aus der Hand gleiten ließ, wissen wollen, wo genau sein Bäumchen gepflanzt wird und ob er es erkennen würde, wenn er persönlich dort hin führe, und ob an jedem Bäumchen eine Platte mit Vor- und Nachnamen angebracht werde, wie in einem Arboretum an seltenen, exotischen Bäumen und Exemplaren aus der Pflanzenwelt. »Nein«, sagte ich in der Absicht, die Qual des alten Mannes noch zu verstärken. Einer Kiefer reicht es, wenn sie Weißkiefer, Schwarzkiefer, vielleicht noch Goldkiefer oder ähnlich heißt, in einer lebendigen oder toten Sprache, auf Serbisch, Englisch oder Latein, sie braucht nicht noch zusätzlich einen Vor- und Zunamen. Auch ich würde nicht wollen, dass sich eines Tages ein Baum aus dem Wald absondert, auf mich zukommt und sagt: »Ich bin Daniel Stern, dein Bruder. Du und deine Mutter, ihr habt mich für ein Pfund gekauft. Ich gehöre euch«. Und dann mit uns nach Hause geht.«
Im Übrigen wusste ich, dass Wälder wachsen, sich ausbreiten und die Welt besiedeln, weniger durch den Willen der Menschen und gemäß ihren Plänen als vielmehr durch das Spiel des Schicksals, des Windes und des Wassers, und dass die Bäume, die du und ich in den deprimierenden Zimmern rekrutieren, dort wachsen werden, wo es das Schicksal für sie bestimmt oder sie selber wollen, an strahlenden Gebirgshängen, an den Rändern der Kontinente, weit genug weg, um von den Quittungseigentümern weder gesehen noch erkannt zu werden.
Zum Hausbesuch bei den Lebls war ich mit viel Zögern und Neugier aufgebrochen. Sonja Lebl war mein Jahrgang, sie beendete gerade die achtjährige Grundschule. Wir waren keine Freunde, ja noch nicht einmal offiziell miteinander bekannt; bei Begegnungen im Schulhof oder Flur tauschten wir mehr oder weniger bedeutungsvolle Blicke statt Grüßen: wir waren die einzigen Juden in der Schule, und in unserer Generation einschließlich Lila Klein und Joška Tešić wohl auch die einzigen in der Stadt, aber wir benahmen uns, als würden wir dem nicht sonderlich viel Bedeutung beimessen, was wir wohl auch nicht taten. In Gegenwart von anderen machte ich, wann immer ich Gelegenheit dazu hatte, klar, dass zwischen uns nichts war. In etwa so wie bei Halbgeschwistern, Bruder und Schwester von einem gemeinsamen, ziemlich problematischen Vater: sie waren zwar verwandt, jedoch brachte sie das einander nicht näher, und es freute sie auch nicht, sondern erinnerte sie lediglich an das gemeinsame Leid, die Peinlichkeit und Scham. Dennoch, genau wie so ein Halbbruder, bemühte ich mich aus der Ferne von der Seite stets um sie. Ich wusste, was sie für Schulnoten hatte, mit wem sie befreundet und in wen verliebt war. Sie war rundlich, gründlich, mit olivgrüner Haut und schwarzen lockigen Haaren, die sich widerspenstig aus dem buschigen Pferdeschwanz entwanden, um den eine brave breite weiße Schleife gebunden war. Sie gefiel mir nicht sonderlich, doch verzieh ich anderen keine Bemerkung über sie. »Blöde Kuh«, sagte ich einmal vor eine Gruppe Klassenkameraden, wodurch ich mein Urteil besiegelte und die kleinen Bemerkungen und Bissigkeiten der anderen überflüssig machte. Ein paar Wochen später begab es sich, dass Sonja endlich erfuhr, dass sie nicht als Tochter von Helena und Rafael Lebl geboren worden, sondern deren Nichte war. Angeblich war eine Frau auf der Straße auf sie zugegangen und hatte gesagt: »Herr Rafael Lebl ist nicht dein Vater, sondern ein Onkel, und Frau Helena deine Tante. Dein Vater hieß Leopold und deine Mutter Emma, ich habe bis zum Krieg bei euch gearbeitet. Ich dachte, Gott würde es mir übelnehmen, wenn ich dir das vorenthielte.«
Rafael Lebl und seine Frau waren keine Mitglieder der jüdischen Gemeinde und konnten nicht sofort begreifen, um was für Bäumchen und was für Einzahlungen es sich handelte. »Ah ja, da ist so ein Schreiben gekommen«, sagte Rafael, »meine Frau und ich werden dieser Tage bei der Gemeinde vorbeischauen und bezahlen.« Im Wohnzimmer der Lebls war es stickig, die Fenster geschlossen, damit der kleine grüne Wellensittich, den man aus dem Käfig gelassen hatte, nicht auf die Straße flog. Aus dem Nachbarzimmer hörte man Geraschel, Schritte auf dem Parkett und Schranktüren quietschen – wahrscheinlich Sonja. Ich wollte nicht fragen, ob sie zu Hause war. Wir entschuldigten uns, dass wir ungebeten gekommen waren; sie wiederum, dass wir wegen ihrer Nachlässigkeit Zeit verlieren mussten. Die Dame des Hauses brachte eine Flasche selbstgemachten Kirschlikör, Rafael fiel ein, dein Mann könne vielleicht den berühmten Radoslav Mijuški gekannt haben, einen Vorkriegsattaché in der serbischen Regierung, Stimmwerber für den Abgeordneten der Radikalen Cveta Maglić. Nach dem Krieg war er Angestellter beim Amt für Sozialversicherung, wurde aber bald wegen diverser Spekulationen verhaftet und zu drei Jahren Haft verurteilt. Nach dem Gefängnis fuhr er mit seinen einträglichen Geschäften fort. Er stellte Stempel erfundener Firmen her und stempelte damit Bestellformulare verschiedenster Firmen in Zagreb, Sarajevo, Skopje und anderen Städten. »Erinnern Sie sich, Frau Stern? ‘Te-Ko’, ‘Agrometal’ und viele andere. Die Ware kam am Bahnhof Sombor an und wurde dort von Vertrauensleuten in Empfang genommen. Die Lieferanten wurden nicht bezahlt, doch die teure Ware verkaufte er zu gepfefferten Preisen in der Vojvodina und rings umher. Er lebte auf großem Fuße, es kam vor, dass er in einer Nacht 30.000 Dinar ausgab. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden hunderte Kilos Anilinfarbe beschlagnahmt, einige Rollen feinsten Stoffes, viel Geld und jede Menge Stempel nichtexistierender Unternehmen …«
Du hörtest ihm angespannt zu, die Stirn in Falten gelegt, und versuchtest dich an diesen berühmten Mijuški zu erinnern, in dessen Gebiss dein Mann sehr wahrscheinlich Zahnfüllungen und goldene Brücken angebracht hatte; dann bemerktest du, dass der blanko gestempelte Quittungsblock noch auf der Spitzentischdecke lag. Der Kreis und der sechszackige Stern sowie die Buchstaben des Stempels der Jüdischen Gemeinde Novi Sad waren unscharf, zerlaufen und zögerlich; du verdecktest ihn wie zufällig mit der Hand und schobst ihn in deine Handtasche. Was man mit solchen Quittungen alles tun konnte, dachte ich mir, niemandem etwas wegnehmen, jedem alles quittieren. Ich hätte erfundene Schulden quittieren und mich selbst einer erfundenen Schuld bezichtigen können. Ich könnte eine Quittung ausstellen für jeden Bissen, den ich in meinem Elternhaus gegessen habe. In meinem Alter könnte ich auch schon alle Schulden zusammenrechnen und einen Strich darunter ziehen. Ich befürchtete, dass uns die Lebls nicht vertrauten, dass sie uns misstrauisch anschauten wie Handlungsreisende, die hundertjährigen Nebel oder die Gipfel des Himalaya, Wälder und Seen in der Wüste verkauften und ihrem Leid nur noch ein weiteres Übel hinzufügen wollten.
Sie kam in dem Moment ins Esszimmer, in dem wir gerade Richtung Diele aufbrechen wollten. Wenn man am Ende eines missglückten, verfehlten Besuches hereinkommt, konnte das kein Zufall sein, sondern es war berechnend, auf eine bestimmte Wirkung hin zielend.
»Guten Tag, Frau Stark«, sagte sie mit höflichem Ernst. »Hallo, Nenad.« Sie hatte mich noch nie im Leben angesprochen. Sie grüßte uns mit dem Entgegenkommen einer freundlichen Hausfrau und ging sofort zur Sache über:
»Mama, warum sollten wir nicht sofort für je ein Bäumchen für meine verstorbenen Eltern bezahlen? Ich habe ein wenig gespart. Ich hole das gleich.«
Ihre Haare waren am Hinterkopf zusammengebunden, aber nicht zu einem Pferdeschwanz, sondern einem leicht hängenden Dachs- oder Hundeschwanz. Ihre Freundlichkeit war kühl, gekünstelt, sie glaubte, sie sei über Nacht zur Frau geworden und war zu allem bereit, um das unter Beweis zu stellen. Ob es daran lag, dass sie erfahren hatte, dass sie nicht die Tochter ihrer Eltern war? In der Tat befürchtete auch ich, dass das Heranwachsen nichts als eine Reihe von Niederlagen war, von unerwarteten Erkenntnissen, mit denen man die Kindheit von sich abwusch, schälte, ablegte und schüttelte wie verkrusteten Schlamm von der Hose nach einer Schlägerei.
Doch sie kam nicht mit ihrem Ersparten wieder. Stattdessen rief sie mich in ihr Zimmer, um mir ein Briefmarkenalbum zu zeigen, das ihre Eltern hinterlassen hatten. Dort gab es dreieckige Marken von Mauritius, Madagaskar, der Jüdischen Autonomen Oblast Birobidschan. Es stellte sich heraus, dass das Album schon lange da gewesen war, doch sie hatte gerade erst erfahren, dass es ihr Eigentum war. Sie musste dringend etwas damit unternehmen.
»Was meinst du, was soll ich mit dem Album machen? Rafi sagt, es sei eine wertvolle Sammlung.« Ihren Vater Rafael nannte sie nun Rafi. »Ich habe keine Lust, es weiter zu vervollständigen; wenn ich es verkaufe, wird man mich betrügen, wenn ich es aufbewahre, was soll ich dann damit? Briefmarken sammeln irgendwelche muskulösen Träumer, Feiglinge, die ihre Augen vor der Realität verschließen. Weißt du irgendetwas über Briefmarken und Philatelie?«
»Soll ich es für dich verkaufen?«
Ich beschloss Folgendes: Wenn Sonja ihren Fall erwähnte, konnte ich jetzt mit ihr darüber reden. Ich würde ihr sagen: »Siehst du, ich habe überlebt, doch mein Bruder Daniel, der Erstgeborene, nicht. Warum und wie? Weil ich einwilligte, getrennt zu werden, meine Eltern zu verraten, aber Daniel nicht. Weil ich 1944, direkt vor der Deportation, wortlos bei Unbekannten geblieben war, einer gewissen Katica und ihrer Mutter, da ich im Gegensatz zu meinem Bruder mit kaum vier Jahren kapiert hatte, dass dies die einzige Art war, zu überleben, und Daniel mit seinen sechs Jahren beschlossen hatte, dem unter diesen Bedingungen nicht zuzustimmen, er klemmte sich an Mamas Hand und ließ nicht los, um nichts in der Welt. Ich ließ sie fallen, Daniel nicht. Du hast diese Probleme nicht. Und schließlich ist es ja wichtig, dass du geliebt wirst« … an dieser Stelle sank meine Stimme zu sehr männlichen Tiefen, und mit dieser neu erworbenen männlichen Kraft holte ich von dort die Botschaft hervor: »… und hättest du alles in deinen reiferen Jahren erfahren, und nicht, sagen wir, im empfindlichsten Alter, wenn du …« und so weiter, und dann würde ich sie für alle Fälle fragen, was wahr war: dass jene ehemalige Dienstmagd sie an der Ecke der Ulica Zlatne grede angehalten und ihr ihre Geschichte erzählt hatte, oder ob es stimmte, dass sie die ganze Sache selbst in der Straßenbahn aufgedeckt hatte, als sie aus der Schule kam und mit ihrem Zeugnis zum ersten Mal auch ihre Geburtsurkunde erblickte, die sie auch früher schon mit in die Schule und wieder nach Hause gebracht hatte, und die Namen ihrer Eltern und Adoptiveltern las, sich durch die volle Straßenbahn kämpfte bis zum Fahrer und diesem zurief, er solle halten, und dann zur Tür stürmte.
»Verstehst du was von Briefmarken?« fragte sie mich, und ich wusste nicht, was ich antworten sollte.
»Sieh mal, ich bin …« fing ich an, doch Sonja packte meine Hand, schob ihr Gesicht vor meins, sorgfältig darauf achtend, dass sie mich mit ihren vollen Entenbrüsten nicht berührte, und drückte entschlossen ihre Lippen auf meine. Gleichzeitig ergriff sie auch meine andere Hand, um mich so daran zu hindern, sie zu umarmen oder wegzuschieben. So unerfahren ich auch war, ahnte ich dennoch sofort, dass in diesem Kuss keinerlei Verlangen, Zärtlichkeit oder Aufruf zur kooperativen Zuneigung lag, ebensowenig Herausforderung, Vertrauen oder Trotz, Versuchung. Als hätte sie mich geküsst, um mich mit Grippe oder Erkältung anzustecken, um mir Gelegenheit zu geben, in der Schule zu fehlen; mehr als alles andere war dies eine Vorstellung für die jenseits der Tür, die falschen Eltern und alle anderen im Wohnzimmer, eine an sie gerichtete Herausforderung, ein lautloser Aufruf, zufällig die Tür zu öffnen und ein unziemliches Bild von Ungehorsam und Protest vorzufinden. Der Kuss war ein Krampf; als hätten wir in den paar Sekunden mit unseren Mündern und Zähnen den heruntergelassenen Vorhang eines kleinen dilettantischen Haustheaters festgehalten, um dem Publikum zu suggerieren, dahinter spiele sich etwas ab, eine herzergreifende Handlung.
Als der Kuss nachließ und die Lippen sich wieder voneinander entfernt hatten, folgte ich ihnen, und erst in Sonjas unerwartetem Rückzug erahnte ich das Verlangen, das bei ihrer Annäherung und ihrem Kuss gefehlt hatte. Die sich entfernenden Lippen gehörten nun nicht mehr jenem unbeholfenen, beleidigten Backfisch, der sie soeben angeboten hatte, sondern einem jungen Mädchen, das in diesem ungeschickten Körper gerade erst zum Leben erwachte.
Und tatsächlich verwandelte sich Sonja kurz nach unserem Besuch bei den Lebls aus einem entenförmigen, festbrüstigen Mädchen fast blitzartig in eine Frau, wie ein Stück Ton auf der Töpferscheibe in eine Vase, durch deren schmale Taille zwischen den runden Brüsten und Hüften gerade einmal ein dünner Strauß Schnittblumen hindurchpassen würde. Ihre Gesichtshaut war rein geworden, die Härchen an den Schläfen ausgedünnt, die zuvor schamhaft eng stehenden Augen an den richtigen Platz gerückt; mit einem Wort – sie war plötzlich erwachsener und schöner geworden und hatte mich vergessen.
Doch für mich bewahrte dieser Kuss einen anderen Sinn, eine besondere Bedeutung, er gab meinem Problem, das mich quälte wie Juckreiz, Namen und Form: Auch ich war nicht der leibliche Sohn meiner Eltern. Sonja hatte mich durch diesen Kuss ermahnt, benachrichtigt, belastet, gebrandmarkt, verraten; mich mitgeschleift; sie hatte mir klargemacht, dass auch ich mit einer Lüge herangewachsen war, und vielleicht gar nicht der war, der ich zu sein glaubte. Aus diesem Kuss sollte ich die Botschaft mitnehmen, dass ich vielleicht gestohlen war, adoptiert als Ersatz für Daniel, ungefähr so wie sein Baum, der ihn auf Erden repräsentieren sollte. Ich hatte nicht das Bedürfnis, das zu überprüfen. Trotz den Dokumenten und allen möglichen Zeugnissen von Katica und ihren Eltern darüber, wie sie mich versteckt und behütet und schließlich nach der Befreiung wohlbehütet wieder zu meinen Eltern zurückgebracht hatten, festigten sie lediglich meine Überzeugung, auch ich sei Teil einer parallelen Aktion der Aufforstung, der Vertuschung. Warum sollte sich mein Schicksal von Sonjas unterscheiden; der Tod war stets wahrscheinlicher als das Leben, die Lüge wahrscheinlicher als die Wahrheit. Die Zeitungen jener Tage waren voll von Berichten über die Suche nach den Brüdern Finaly, und auch in unserem Haus wurde viel darüber geredet. Es handelte sich um zwei jüdische Jungen, die während der Besatzung, nach der Deportation ihrer Eltern, einer Französin anvertraut worden waren, die sie als Katholiken großzog und sich nach dem Krieg, als klar war, dass die Eltern im KZ umgekommen waren, weigerte, sie ihrer Tante zurückzugeben. Die Jungen verschwanden spurlos, ganz Frankreich suchte nach ihnen, die Spannung stieg wie im Kino. Die beschuldigte Frau Antoinette Braun versteckte sie zunächst in französischen und dann in einem spanischen Kloster, wo ihre Spur verschwand. Millionen waren tot, aber alle, auch deine Schwester, schimpften über die Katholikin Antoinette, als hockte sie im Nachbarzimmer und lauschte; doch ich war auf ihrer Seite, ich hoffte, dass die Jungs nie gefunden und ihren Verwandten zurückgegeben wurden; ich wollte, dass sie in einem geheimnisvollen, finsteren Kloster blieben, dass die scheinbare Gerechtigkeit nie hergestellt wurde, die tröstliche Lüge nicht siegte; das Leid gezeigt wurde, die brutale Wahrheit. Und als endlich bekannt wurde, dass Robert und Gerald dank der aufwändigen Kampagne und der Aktivitäten der jüdischen Gemeinde in Frankreich gefunden worden seien, fühlte ich mich besiegt; ich begriff, dass die Friedhofsgerechtigkeit über das Risiko und die Abenteuerlust gesiegt hatte und dass es Robert und Gerald nicht gelungen war, der Lüge des halbglücklichen Endes zu entkommen, der Heimkehr der verlorenen Söhne, der Zeremonie der allgegenwärtigen tröstlichen Operation der Vertauschung. Ich wünschte mir, das wahre Angesicht der Dinge möge sich zeigen. Es gab keine erfolgreiche Vertauschung, keinen Trost; ein jeder sollte schmachten, eingekerkert in seinem eigenen Kloster.
Daniel war durch den Tod zum Gewinner geworden. Für ihn gab es eine Büste im Schlafzimmer, einen Baum auf 900m über der Meeresspiegel, seine Liebe und mich, den Lebenden, als Ersatz. Die ganze Welt hallt mit seinem Namen wider: Dan-Dan! Die Glocke der orthodoxen und der katholischen Kathedrale, jede Stunde, an der Friedhofskapelle, die Glocke am Feuerwehrauto, an der Straßenbahn, der altertümlichen Kutsche, die Schulglocke, mindestens zehnmal täglich, die Glocken an den Schiffen und Schleppern, die in beide Richtungen die Donau entlang tuckern, der Adria und den entfernten Meeren, alle Alarmglocken, die Glocken der Leithammel und an den Rinderhälsen, die Glocken an den Hälsen der Aussätzigen und Schwachsinnigen, alle Glocken – Dan-Dan-Dan-Dan. So macht mein Bruder Daniel sich bemerkbar und teilt sich mit, erkennt von Bild zu Bild, von Geräusch zu Geräusch, von Geläut zu Geläut, Klang zu Klang, ruft mich, fordert mich heraus, irritiert und neckt mich und windet sich heraus. Wir waren nicht gleichberechtigt, er regierte über eine Welt, in der ich erfolglos versuchte, meinen Platz zu finden. Er, der Unwirkliche, war der wahre Sohn, ich, der wirkliche, war ein unklarer, unvollständiger, nicht anerkannter Ersatz. Es wäre leichter für mich gewesen, hätte ich einen greifbaren Beweis gehabt, dass ich nicht dein Sohn qua Geburt war. Im Wäldchen an der Donau, unweit vom Schulsportplatz, suchte ich mir eine Weide aus, an der ich mich erhängen wollte, wenn die Zeit gekommen war. Die Zeit sollte im Mai des Folgejahres 1954 kommen, zum zehnten Jahrestag von Daniels Tod. Ich wollte bis dahin sechzehn Jahre alt geworden sein und alles vorbereiten für meinen Plan, damit der Selbstmord Ausdruck meines freien Willens und meiner Reife war. Doch ich hatte zu viel geplant, so viel, dass ich nicht alles schaffte. Und auch Luka verlangte viel von mir: die ganze Grammatik und Rechtschreibung der serbokroatischen Sprache, außerdem Krieg und Frieden und Die toten Seelen, die nicht Bestandteil der Pflichtlektüre waren. Deshalb war ich, als der besagte Tag kam, auch nicht bereit. Ich ging dennoch zum Wäldchen, zum ausgewählten Baum, fest entschlossen, mit der Spitze meines Taschenmessers ein Zeichen darauf zu hinterlassen, bis auf weiteres. Es war ein schöner, kerniger Baum mit glatter Rinde, und als ich den ersten Strich meiner Initiale machte, begann die Rinde sich zu lösen und ich hörte den Baum »NE«, nein, sagen. Ich zuckte zusammen, doch die Klinge ritzte von allein darunter ein »DA«, ja. So waren wir beide eingeritzt, ich, Nenad und mein Bruder Daniel, ich der Leugnende und er der Bejahende, Einverstandene. Ich hatte nicht aufgegeben, nur aufgeschoben. Der Baum war der, der sich das merken sollte.
»Und, willst du nun für deine Eltern bezahlen?« fragte ich, um meine Verwirrung zu verbergen. Es klang in der Tat blöd, als hätte ich sie gefragt, ob ich zwei Kinokarten kaufen solle. Und vielleicht hatte ich auch so etwas im Sinn. Gerade liefen die Verbotenen Spiele von René Clemant, und obwohl ich mir sonst niemals einen solchen Film anschauen würde, stellte ich mir vor, dass ein Mädchen wie Sonja ihn auf jeden Fall sehen sollte, genauer gesagt, dass es ein Film war, den man sich mit ihr gut anschauen konnte.
Im März 1954 kehrte Eva Berger, die mit der ersten Gruppe Aussiedler gegangen war, unerwartet aus Israel nach Novi Sad zurück.
»Da bin ich, wieder zu Hause, ich bin heimgekehrt!« sprach sie, während sie vom Trittbrett des Schnellzugs hinuntersprang, der sie aus Rijeka direkt in die Umarmung von Olga Roth gebracht hatte, »ich dachte, ich wache nie wieder auf.«
Die Freundinnen weinten fast den ganzen Heimweg in der Kutsche, bis zu Olgas Wohnung. Als der Kutscher das Gepäck auf den gefrorenen Rasen auslud, musste Olga sich kurz völlig entkräftet auf den größten Koffer setzen: ‚ich bin froh, dass du wieder da bist‘ wollte sie sagen, doch ihre Stimme versagte.
»Da bin ich, ich bin heimgekehrt«, es lag etwas Berauschendes in diesem Satz, den Eva Berger wieder und wieder sagte, beim Treffen mit alten Bekannten und ihren wenigen Verwandten; zu Beginn ganz aufgeregt, mit Wärme und Freude, die sie von jenen erwartete, zu denen sie zurückgekehrt war, später mit immer mehr Zögern, Unsicherheit und Schuldgefühlen, die den Satz auf »Da bin ich« zusammenschrumpfen ließen. Sie war da, das war das einzig Unstrittige, ob sie heimgekehrt war oder gerade erst von zu Hause fortgegangen, war eine Frage, die nur von der Geschichte beantwortet werden konnte. Jene, die seinerzeit nicht genug Entschlossenheit und Mut gehabt hatten, selber auszuwandern, nahmen Eva jetzt übel, dass sie den gemeinsamen Traum vom gelobten Land verraten hatte, doch heimlich, sogar vor sich selbst verborgen, waren sie ihr dankbar, dass sie zurückgekehrt war, denn ihre Angst vor neuen Schwierigkeiten und einem Neubeginn in einem neuen Land – sie war begründet.
Olga Roth war seinerzeit die einzige Person gewesen, die Eva den Wegzug hatte ausreden wollen. Doch Eva war damals nicht zu halten. Seit dem Augenblick, da sie 1944 mit einer Kugel im Oberschenkel und gebrochenen Rippen in einem Leichenhaufen in Bergen-Belsen aufgewacht war, hörte sie nicht auf, aus einem Traum in den nächsten zu fliehen, vielmehr aus einem Aufwachen ins nächste. Als sie im Frühjahr 1945 im Kurbad Palić nackt aus einer Badewanne stieg, sagte sie »ich dachte, ich wache nie wieder auf.« Nur vier Jahre später, im Morgengrauen, nach einer mondlosen Mittelmeernacht, während das Schiff sich dem Hafen von Haifa näherte, sagte Eva, auf Zehenspitzen stehend, um durch die verschlafene Masse von Emigranten zumindest für einen Augenblick den bläulichen Berg Karmel zu erspähen, erneut: »Mein Gott, ich dachte, ich wache nie wieder auf.« Eva konnte nicht erklären, warum die vier Jahre, die sie im Novi Sad der Nachkriegszeit verbrachte, für sie zum Alptraum geworden waren, ebensowenig konnte sie jetzt erklären, warum sie aus Netanya geflohen war. Sowohl das Leben im Novi Sad der Nachkriegszeit als auch das in Israel der Nachkriegszeit hatten begonnen wie von der Morgensonne beschienen, doch sie waren bald verbraucht, verschwanden hinterm Horizont, verdichteten sich zu einem schweren, finsteren Traum. So war auch jetzt jede Schulter, auf die sie sich in Erwartung eines Willkommensgrußes warf, um einen Schatten düsterer als die vorherige, und vielleicht würden noch nicht einmal vier Jahre vergehen, bevor sie sich an einem dritten Ort die Augen rieb und einer gleichgültigen Zufallsbekanntschaft zuflüsterte: »Ich dachte, ich wache nie wieder auf.«
**
An den Hängen der judäischen Berge wurden Wurzeln geschlagen, Leben erneuert, und weder die Regengüsse des Winters noch die Dürren des Sommers noch die Wüstenwinde konnten diesen Wurzeln etwas anhaben.
Doch im Spätherbst 1954, nach über einem Jahr des Schweigens, schrieb Sara einen langen Brief. Die Handschrift war ihre, doch war diese aufgeregt, aufgewühlt, beunruhigt; sie war nicht verändert, doch glitt sie hinab, wand sich, neigte sich mal zur einen, mal zur anderen Seite, und die Zeilen flohen von den Linien auf dem dünnen Papier und glitten hoffnungslos davon, um sich schließlich in der unteren rechten Ecke abzulagern wie ein Haufen trockener Zweige; sie fielen vom schmalen Briefpapier, flohen zur Seite.
»Ich wusste es«, flüsterte Olga entsetzt.
»Eine neue Affäre! Finaly!« rief der alte Sonnenfeld, der das Bulletin der Jüdischen Gemeinde in der Hand hielt, »das jahrelang vermisste dreizehnjährige Mädchen, die Jüdin Anneke Beckmann, dessen Eltern im Krieg getötet wurden, war in ein Kloster bei Lüttich gebracht worden. Als die Gerichtsbehörden kamen, um das Kind zu holen, war dieses verschwunden, zusammen mit der Nonne, der es anvertraut worden war. Jetzt suchte man die beiden und hatte in diese Richtung Vermisstenmeldungen herausgegeben. In Holland hatte es einen ähnlichen Fall gegeben, der glimpflich geendet war. Ingesamt dreimal war ein jüdisches Mädchen gefunden worden, jedes Mal hatte man es in einem Kloster versteckt gehalten. Es handelte sich um die dreizehnjährige Rebekka Melhade, deren Eltern in Auschwitz vergast worden waren. Sehen sie, Olga, unsere Kinder kommen aus den Verstecken, sie kommen ans Tageslicht!
Die Sonnenfelds hatten keine Kinder. Sein Bruder hatte zwei und dann eines verloren, weshalb er auch keine Zeitung mehr las, Nachrichten interessierten ihn nicht mehr. Vor dem Krieg, als alle Kinder hatten, sagte die Sonnenfeld nicht »unsere« Kinder, denn es waren fremde Kinder. Mittlerweile, da niemand mehr Kinder hatte, waren all diese Kinder, die nicht überlebt hatten, die es nicht mehr gab, die niemand hatte, auch ihre. Zwischen ihr und den anderen Frauen gab es nun keinen Unterschied mehr. Der alte Sonnenfeld war an den Rollstuhl gefesselt, im Gegensatz zu seinem Neffen, dem einzigen überlebenden Verwandten, der anstatt bei seinem Vater beschlossen hatte, bei ihm zu leben, las alle Nachrichten, die ihm der Neffe selber brachte. Er war Übersetzer und verfolgte alle Neuigkeiten, die Geschichte über die Brüder Finaly konnte er von vorn bis hinten auswendig. Er wusste auch die Zahl der Männer und Frauen in der Gruppe bulgarischer Juden, die auf ihrem Weg nach Israel Belgrad passiert hatten, und wie sie angekommen waren. Er wusste, wer von den Landsleuten in Israel zurechtgekommen war, wann die Sterns aus Sombor Zwillinge bekommen hatten oder wann Gaon Lunenfeld in Jaffa auf der Schwelle seines Hauses getötet worden war. Sie brachten ihm Texte und Zeitungen und nahmen sie wieder mit, sein Lebensraum reichte nicht weiter als bis zum Terrassengitter, doch er wusste alles, was in der Zeitung stand, und sogar mehr als das.
Es war dies ein Jahrzehnt des Gewöhnens an das Leben, es dauerte zehn Jahre, dieses Wunder als Tatsache zu akzeptieren. Doch genau zu dieser Zeit bekamen diese kleinen einzelnen Wunder der Erlösung, nach der Gewöhnung an die allgemeine Leere, an die allgemeine Abwesenheit von jedem und allem, das ihr Leben früher ausgemacht hatte, auf einmal die Tendenz, sich zu erweitern. Als hätte es dieses Jahrzehnt der Gewöhnung und Akzeptanz der Leere und des Nichts nie gegeben, nach der Meldung der ersten Rückkehrer aus Geschichten und aus Notunterkünften (endlich traute sich der junge Marko Anaf, aus dem Versteck vom Dachboden herauszukommen) machte sich auf einmal eine allgemeine Erwartung breit. Es war der Moment, in dem sich das Wunder als allgemeingültige Regel erwies.
Durch das Zimmer von Samuel Sonnenfeld, aber auch außerhalb davon, entflochten sich Geschichten von großen Transporten jüdischer Kinder und Frauen, die die Deutschen nach Absprache mit einem hochrangigen Offizier Hitlers und den amerikanischen Juden den Russen überlassen hatten, damit sie sie mit der Transsibirischen Eisenbahn in ein Land im fernen Osten brachten. Eine zweite, noch unglaublichere Geschichte handelte von Dutzenden – später stellte sich heraus, dass es Hunderte waren – riesiger Segelschiffe, die mit geretteten Kindern beladen durch die Südsee segelten und sich auf unbewohnten Inseln des Pazifik, den Solomon Islands, mit Nahrung und Trinkwasser versorgten.
Das Leben wirkte nach vielen Jahren wie eine Sammlung von Geschichten. Einige waren wahr, einige wirkten so, wieder andere waren in der Tat erfunden. Zu der Zeit wirkte die Aktion vom »Wald der Märtyrer«, das Zusammenzählen der Toten, wie eine dieser Geschichten. Jeder Baum war ein Beweis, dass ein Mensch gefunden worden war, dem Tod entkommen, dass er gerettet war und wiederkehren würde.
»Sehen sie mal, auch das hier, Olga« fuhr er fort, offenbar gleichgültig gegenüber Olgas Blässe, während sie den Brief las, »was Leon Leneman in der Zeitschrift Evidences schreibt: ‚Ganz unerwartet redet man mittlerweile wieder von der »Jüdischen Autonomen Oblast Birobidschan«. In einem offiziellen Communiqué der Moskauer Prawda wird mitgeteilt, dass bei den Wahlen im März 1954 werde die JAO Birobidschan 5 Abgeordnete wählen, zur gleichen Zeit meldet die Birobidschanskaja Swesda, dass in den kommenden Monaten Juden aus Russland, Weißrussland und der Ukraine in Birobidschan angesiedelt werden. Das ist nicht alles. Vor Kurzem war im Radio des autonomen Territoriums zu hören, Birobidschan erwarte eine große Zahl von Immigranten, die auf Kosten der birobidschanischen Lokalregierung kommen würden‘. Sehen Sie! Und ich habe im sowjetischen Kulturhaus einen interessanten Film gesehen, Land der glücklichen Menschen, der genau davon handelt. Das Drehbuch stammt vom Journalisten Isaak Babel, der Jude war wie wir. Das ist keine Propaganda, das ist Realität.«
»Ich wusste es«, schluchzte Olga noch leiser auf.
»Liebe Olga«, schrieb Sara Alkalaj, »ich bin durch die gestrigen Ereignisse sehr beunruhigt, ich kann nicht anders, als dich sofort davon in Kenntnis zu setzen. Mit Freunden, die sich vor Kurzem ein Auto gekauft haben, sind wir losgefahren, um zu sehen, was unsere Bäumchen in Yaar Hakdoshim für Fortschritte machen. Seit wir sie letztes Frühjahr gepflanzt haben, waren wir nicht mehr dort. Tsvi hatte Probleme mit der Gesundheit, wir schoben es immer wieder auf, als hätten wir etwas Böses geahnt. Ich hatte mir die grellgrünen Gärten und Obstgärten in Beit Zayit und Motsa eingeprägt, die wir im Frühjahr aus dem Bus sahen, sie waren mir vor Augen, wenn ich in diesen Monaten an unseren Wald dachte. Doch jetzt, im Herbst, ereilte uns direkt am Stadtrand von Jerusalem ein Regenguss, er fiel vor uns wie ein bleierner Vorhang und als wir die Serpentinen hinabfuhren, eilte er uns voraus und führte uns. Es gelang uns nicht, ihn zu durchdringen, obwohl der Himmel aufzeigte, dass es nur ein paar Schritte von uns entfernt heiter war.
Ich weiß mit Sicherheit, dass wir beim letzten Mal etwa zwanzig Kilometer von Jerusalem rechts abgebogen und auf einer soliden Sommerstraße bergaufwärts gefahren sind. Ich erinnere mich noch genau an das Hinweisschild an der Kreuzung und der Tafel mit der Aufschrift. Auch Tsvi erinnert sich. Doch gestern fanden wir, obwohl wir sehr vorsichtig fuhren, sogar noch, als der Regen aufgehört hatte, weder die Tafel noch das Straßenschild. An der Stelle, wo sie hätten sein sollen, ging zwar ein Weg ab, und ich war auch überzeugt, dass es derselbe war, den wir vor einem halben Jahr genommen haben, obwohl Feuchtigkeit, Nebel und die Herbstfarben viel geändert haben, die Schärfe der Hänge, Höhe der Berge und die Richtung der Wege. Wir fuhren bergauf wie auch beim letzten Mal, doch hinter den Kurven erschienen nackte, steinige Berge wie beim letzten Mal und ein Hochplateau, auf dem wir anhielten sowie der Gipfel des Nachbarbergs, das Tal, das sich zwischen ihnen auftat und ein kleines Dorf auf dem dritten Berg hinter uns, alles war wie beim letzten Mal. Alles, meine Liebe! Die judäischen Berge waren kahl wie beim letzten Mal, nur hier und da von etwas Gestrüpp bedeckt – wie beim letzten Mal! Nichts hatte sich verändert. Keine Spur von unseren Setzlingen, keine Kiefern, kein Märtyrerwald! Tsvi gab sich die Schuld, dass er falsch abgebogen war, doch ich war sicher, dass wir den richtigen Weg genommen und auch dort hingelangt waren, wo wir hinwollten. Unser Freund, gebürtig aus Bratislava, der in seiner Jugend angeblich sogar den Triglav bestiegen hat, hatte das Bedürfnis, uns zu erzählen, dass angeblich in den Berichten einiger Alpinisten, am Rande unzugänglicher Orte in den Anden sogenannte Mausefallen auftauchen, optische Täuschungen, die auch die hartnäckigsten und bestausgerüsteten Bergsteiger in die Knie zwingen. An diesen verhängnisvollen Orten verhält es sich nämlich so, dass egal welchen Gebirgspass man bezwungen hat, auf welchen Felsen auch immer man geklettert ist, das Gelände, das sich vor einem auftut, identisch ist wie jenes, das man gerade hinter sich gelassen hat. Wohin auch immer man geht, es wird sich stets derselbe Anblick vor einem auftun. Und so klettert man immer wieder auf denselben Hang und steigt in dieselbe Schlucht hinab, aus der man gerade herausgeklettert ist. Dazu erschwert die dünne Luft den Fortschritt extrem, der letzte Schritt vor dem Ziel wiederholt sich unendliche Male, der Bergsteiger versinkt in der zurückgelegten Strecke, bis er schließlich aufgibt oder stirbt. Wir einigten uns, in zwei Wochen wieder dorthin zu fahren, aber ich möchte nicht.
Vielleicht bin ich krank, hier sind alle mehr oder weniger krank, ich weiß, dass wir dort waren, wo wir hin wollten, nur der Wald war nicht dort. An den Hängen waren Löcher, halb gefüllt mit Steinen, Spänen und Staub, wie verlassene Höhlen von Wüstenfüchsen. Was war mit dem Wald passiert? Tsvi versucht schon den ganzen Tag, mich zu beruhigen, aber das Problem liegt nicht in mir, sondern in dieser Kraft, die meine Erinnerungen herausreißen, mein ganzes Leben entwurzeln will. Diese Kraft hat mich vor vier Jahren hierher geschleift – ich habe mich ihr gänzlich hingegeben – jetzt packt sie mich wieder am Herzen und schleift an einen wieder anderen Ort, wer weiß wohin, wohl in den Wahnsinn, sie lässt nicht zu, dass ich mich beruhige und zu mir komme. Diese Kraft ist so stark, dass sie sogar einen Baum ausreißen kann, ganze Wälder von einem Ort an einen anderen versetzen. Meine liebe Olga! Die Bäume, die ich mit eigenen Händen gepflanzt habe, sind verschwunden. Der Wald ist weggelaufen. Was wird aus uns werden?
»O mein Gott«, kreischte Olga, und der Brief fiel ihr aus der Hand. Sie war erschüttert, wenngleich sie schon eine gewisse Zeit geahnt hatte, dass nach den Seufzern, Gedanken und Menschen auch der Wald auf einer längst verwehten Karawanenstraße Richtung Osten aufbrechen würde, zu dem von der Geschichte eingezeichneten Bestimmungsort. Kurz nach dem Krieg, beim Besuch ihres Kollektivs im Eisenwerk in Smederevo, hatte sie den russischen Schleppkähnen zugeschaut, die unter der Last von Weizen, Mais und Sonnenblumen, bis zum Hals im Wasser, die Donau hinunter tuckerten, und die langen Güterzüge, wie sie durch Wolken von Dampf und Mehl von der Festung Richtung Horizont verschwanden. »Das kriegen alles die russischen Juden in ihrem scheiß Bidschan da, oder wie auch immer das neue Land heißt«, flüsterte ihr der Hausherr zu, ein alter Maler mit schlechten Zähnen, ohne zu wissen, dass sie die einzige Jüdin in der Gruppe war.
Die Fantasie, eine fantasierte Welt, braucht, ähnlich wie die Menschen, Nahrung. Daher wird die ganze Welt einen Teil ihres Reichtums nach Osten schicken, dorthin, wohin der Wald sich aufgemacht hat. Wenn irgendetwas sicher ist, dann ist es Birobidschan; ein Land, auf das alle unschuldigen Träumereien ausgerichtet waren, schluckt nun jede Erinnerung, jedes Leben, jede Liebe. Dort ist alles entweder Erinnerung oder Vergessen. Die Pflicht eines jeden Juden ist es, zur Idee beizutragen, seinen Beitrag ans Unausführbare zu leisten. Wo auch immer er einen Baum pflanzt, wird zumindest ein Zweig in Birobidschan aufblühen, wo immer er ein Fundament setzt, wird wenigstens eine Mauer in Birobidschan errichtet, vieles von dem, was sich donauabwärts in Bewegung setzt, wird in Birobidschan angeschwemmt werden. Der Mensch und der Schmerz, die wie von Geisterhand verschwinden, werden in Birobidschan auftauchen und wieder auferstehen. Und siehe, den Schiffen sind nun die Kiefern gefolgt, den Kiefern werden Früchte folgen, Schritt für Schritt, Wurzel um Wurzel, dorthin werden Zitronenbäumchen fahren, Feigen, Orangen, Oliven, schließlich auch Eukalyptusbäume und im Fels eingewachsene Kakteen.
Es kann sein, dass in dem Moment niemand außer Olga Roth bereit war, Sara Alkalaj zu glauben. Doch in jenem Jahr war es noch möglich, dass Wälder über Nacht umsiedelten. Wenn die Vorsehung beschließt, den Träumereien unglücklicher Frauen entgegenzukommen, brechen Naturkatastrophen über die Welt herein, geologische Beben und biologische Umstürze; Berge versetzen sich, die Wüste kehrt zurück und verschlingt bewaldete Brachen; auf der Erde entstehen neue Inseln des Glücks und die verfaulten, bösen Kontinente versinken im Vergessen. Denn hegt eine Frau den Wunsch, das Leid ans Ende der Welt zu verbannen, wird die Ferne sich immer mehr entfernen, der Raum sich dehnen, dünner werden und schließlich reißen wie eine Saite; will sie jedoch unerreichbare Träume ergreifen, wird die Nähe näherkommen, werden alle Ziele erreichbar, Land und Ozeane betretbar und jedes Birobidschan Wirklichkeit; die Welt wird kleiner, bis sie auf die Größe eines Kiefernzapfens geschrumpft ist, der in eine Frauenhand passt.
Zwischen den Zeilen
Zwischen den Zeiten
Auftritt TRADUKI – Bühne frei für Südosteuropa! In nahezu 20 Veranstaltungen präsentiert TRADUKI zur diesjährigen Leipziger Buchmesse Autor:innen aus Südosteuropa auf der Messe im traditionsreichen „Café Europa“ und erstmalig in der TRADUKI-Kafana. Unter dem programmatischen Titel „Zwischen den Zeilen – Zwischen den Zeiten“ widmet sich unser Programm den verborgenen Seiten und Momenten des Lebens, der Mehrdeutigkeit von Erfahrungen, Sichtweisen und der Vielfalt von Lebenswelten. Dabei sind der genaue Blick und der intensive Dialog unabdingbar. Die Autor:innen und ihre moderierenden Gastgeber:innen widmen sich den Brüchen, Sprüngen und Kehrtwendungen in den Lebenslinien von Menschen und Ländern. Das heißt auch, dass Kindheitserinnerungen neu interpretiert werden und damit bisweilen für die Vergangenheit Platz in der persönlichen und politischen Zukunft geschaffen werden muss. Das Leipziger TRADUKI-Programm 2023 will die Räume „dazwischen“ besser sichtbar und erfahrbar machen, denn gerade hier spielt sich oft Entscheidendes ab.
Dabei liegen für uns die Fragen nahe: Ist der Südosten Europas vielleicht selbst ein solches „Dazwischen“? Noch nicht hier – nicht mehr dort? Oder gar der Wartesaal Europas? Und man möchte rufen, ja wann kommt endlich Bewegung in die Geschichte (die Doppeldeutigkeit dieses Begriffes lassen wir hier absichtlich bestehen)?!
Unter unseren Autor:innen sind die letztjährige Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Ana Marwan, die slowenisch und deutsch schreibt, der rumänische Autor und Träger des Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung von 2015, Mircea Cărtărescu, die Bosnierin Lana Bastašić, derzeit Stipendiatin im Berliner Künstlerprogramm des DAAD, und die Slowenische Lyrikerin Anja Zag Golob. Darüber hinaus bietet TRADUKI auch in 2023 zahlreiche literarische Neuentdeckungen.
TRADUKI ist längst nicht mehr nur Literatur, sondern auch Film und Musik. Das mit Bedacht kuratierte Filmprogramm der Balkan Film Week stellt, in Anlehnung an das diesjährige TRADUKI-Motto das Moment des „Verschwindens“ in sein Zentrum. Die insgesamt acht filmischen Geschichten handeln von Immigration und Emigration, vom Leben zwischen den Welten und vom langsamen Hinübergehen, Hinüberwachsen in eine neue Lebenswelt. Wie kann das – im Hier und im Dort und im Dazwischen – gelingen, ohne dass die einzelnen sich dabei selbst verlieren oder gar verschwinden? In den slawischen Sprachen haben Verben eine perfekte und eine imperfekte Form, mit denen man die Vollendung oder aber die Nichtvollendung eines Geschehens ausdrücken kann. Izginiti ist nicht gleich izginajti. Beides kann im Deutschen mit dem Wort verschwinden übersetzt werden, aber izginiti heißt: etwas ist verschwunden, nicht mehr da. Izginjati wiederum meint ein langsames, stetes, manchmal umso schmerzvolleres Versiegen: Ohne klaren Bruch und klare Grenzen ist hier die Vergangenheit der Gegenwart stets auf den Fersen.
Bleiben Sie auch TRADUKI auf den Fersen und besuchen Sie uns in Halle 4 / D407, im Café Suedbrause – bei Freunden und im Kino UT Connewitz, wo am Messesamstag abends wieder die legendäre Balkannacht stattfindet: Literatur aus den Ländern des Westlichen Balkan und Musik der in Novi Sad geborenen, heute in Wien lebenden Komponistin und Bratschistin Jelena Popržan.
TRADUKI kooperiert 2023 in vielfacher Weise auch mit dem Gastlandauftritt Österreichs, zu dessen programmatischem Auftritt unter dem Titel «meaoiswiamia» (Mehr als nur wir) wir uns gerne hinzugesellen. Dem Gastlandauftritt des TRADUKI-Partners Slowenien im Herbst 2023 auf der Frankfurter Buchmesse räumen wir in unserem Programm ebenfalls gebührend Platz ein.
Ihr TRADUKI-Team: Angelika, Barbara, Ljubica, Andrej, Marija, Radmila
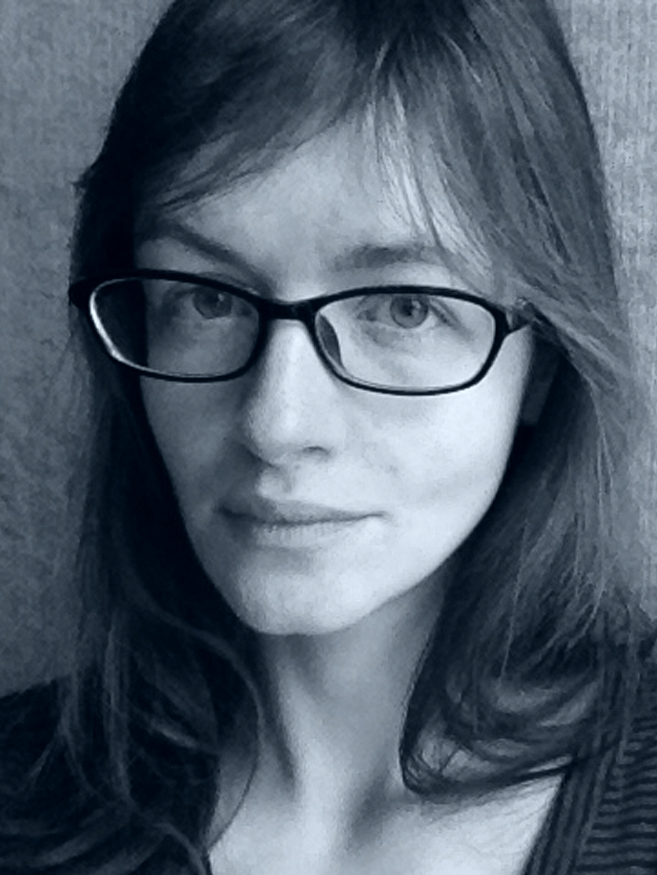
Barbara K. Anderlič
Barbara Anderlič, geboren 1984 in Ljubljana, studierte Translationswissenschaft. 2014 erhielt sie für das Stück Von Schablonen und Romanfiguren den exil-DramatikerInnenpreis der Wiener Wortstaetten. 2015 gewann sie mit A Continental Divide den ITI Global Playwriting Contest. 2021 erschien Samira Kentrićs Balkanalien: Erwachsenwerden in Zeiten des Umbruchs in ihrer Übersetzung bei Jacoby & Stuart, 2023 folgte Jurij Devetaks Graphic Novel Nekropolis (Schaltzeit Verlag), die auf dem gleichnamigen Roman von Boris Pahor basiert. Als Dolmetscherin durfte Anderlič u.a. Graciela Iturbide und Mojca Kumerdej ihre Stimme leihen. 2012 war sie Mitglied der Standard-Publikumsjury bei der Viennale in Österreich.

Shkëlzen Rexha
Ag Apolloni
Ag Apolloni, geboren 1982 in Kaçanik, Kosovo, ist ein Kosovare, der in albanischer Sprache als Schriftsteller, Dichter, Dramatiker und Essayist tätig ist. Er ist Professor für Literaturwissenschaften an der Universität Prishtina. Seine literarischen Publikationen zeichnen sich durch eine dramatische und philosophische Dimension aus, auch seine kritische Haltung gegenüber Geschichte, Politik und Gesellschaft findet darin ihren Niederschlag.

Stephan Boltz
Lindita Arapi
Lindita Arapi, geboren in Albanien, gehört zum Kreis der sogenannten albanischen literarischen Avantgarde. Sie veröffentlicht Gedichtsammlungen, Romane, Essays, und Publizistik. Ihr erster Roman Schlüsselmädchen wurde als Buch des Jahres von Kult Academy in Albanien ausgezeichnet und ins Deutsche übersetzt. Ihr jüngster Roman Die Eingemauerte befindet sich in deutscher Übersetzung und erscheint im Weidle Verlag. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet Lindita Arapi als freie Hörfunkredakteurin der Deutschen Welle in Bonn und Übersetzerin.

Esad Babačić
Esad Babačić, Schriftsteller und Sänger der legendären Punk-Band Via ofenziva, gilt als der originellste und namhafteste Vertreter der slowenischen Literaturszene. Sein Werk umfasst zahlreiche Bücher und Gedichte, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. 2003 erhielt er für sein Gedicht Donava den österreichischen Hörbiger-Preis. Übersetzungen seiner Texte sind in allen größeren europäischen Sprachen erschienen, unter anderem in den Zeitschriften Die Batterie, Literatur und Kritik und Edinburgh Review.

Radmila Vankoska
Lana Bastašić
Lana Bastašić, 1986 in Zagreb, Kroatien, als Kind serbischer Eltern geboren, wuchs nach dem Zerfall Jugoslawiens in Bosnien auf und lebte zuletzt viele Jahre in Barcelona. Mit ihrem Debütroman »Fang den Hasen« stand sie auf der Shortlist des NIN-Award, Serbiens renommiertesten Literaturpreis, erhielt 2020 den Literaturpreis der Europäischen.

Agata Szymanska-Medina
Elona Beqiraj
Elona Beqiraj lebt und arbeitet in Berlin. Sie gibt Workshops zur Kontinuität Rechter Gewalt in Deutschland und hat diesbezüglich im Maxim Gorki Theater unter anderem das Kunstprojekt „Weil wir nicht vergessen“ geleitet, das sich einer würdevollen Erinnerungskultur widmet. In ihrem Gedichtband „und wir kamen jeden sommer“, der 2019 im Resonar Verlag erschienen ist, beschäftigt sie sich der Frage nach Zu- und Unzugehörigkeit in Deutschland. Zudem gibt sie Schreibworkshop, die sich ebenfalls diesen Themen widmen.

Ralf Beste
Ralf Beste, geboren in 1966 in Witten, Studium der Geschichte in Bochum, Bielefeld und Baltimore (Master of Arts, Johns Hopkins University; Magister Artium, Universität Bielefeld). 2001 bis 2014 Redakteur des SPIEGEL. 2014 bis 2016 Stellvertretender Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen Amt, von 2016 bis 2017 dort Beauftragter für Strategische Kommunikation und 2017 bis 2019 Leiter des Planungsstabes. Von 2019 bis Anfang 2022 war Ralf Beste Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Republik Österreich. Jetzt leitet er die Abteilung für Kultur und Kommunikation des Auswärtigen Amtes.

Martina Bitunjac
Martina Bitunjac ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien. Sie lehrt am Historischen Institut der Universität Potsdam und ist außerdem geschäftsführende Redakteurin der Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören der Zweite Weltkrieg und der Holocaust in Südosteuropa, Täter:innenforschung, Erinnerungskultur und jüdische Geschichte auf dem Balkan.

Mircea Cărtărescu
Mircea Cărtărescu wurde 1956 in Bukarest geboren und lebt in seiner Heimatstadt. Zahlreiche Auslandsaufenthalte u. a. in Berlin, Stuttgart, Wien, Florenz. Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung (2015), Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur (2015), Thomas-Mann-Preis, Premio Formentor (beide 2018). Auf Deutsch erschienen zuletzt die „Orbitor“-Trilogie (2007 bis 2014), der Erzählungsband Die schönen Fremden (2016), der Roman Solenoid (2019) und Melancolia (2022). 2022 wurde er mit dem FIL-Preis für romanische Sprachen ausgezeichnet.

Ekko von Schwichow
Antje Contius
Antje Contius, geboren 1966 in Nordhessen, hat seit 2008 die Geschäftsleitung der S. Fischer Stiftung inne. Sie studierte Slawistik in Münster, Freiburg, Frankfurt/Main, Moskau, Warschau und Sofia. Als freie Lektorin war sie für Verlage in Österreich, Deutschland und der Schweiz tätig und besonders für osteuropäische Literaturen engagiert. Diesen Schwerpunkt verfolgte sie auch als Osteuropa- und Nahostreferentin in der Auslandsabteilung der Leipziger Messe und von 1995-1998 als Leiterin dieser Abteilung. 2002 kam sie zur S. Fischer Stiftung.

IGUE
Jacqueline Csuss
Jacqueline Csuss arbeitet seit den 90er Jahren als Übersetzerin von Literatur, Autobiographien und Sachbüchern sowie von Texten für internationale Organisationen aus den Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch. Die Übersetzung von „Alabama Moon“ des US-Autors Watt Key war für den deutschen Jugendbuchpreis 2010 nominiert. 2010 wurde sie mit dem Kunstpreis der Republik Österreich ausgezeichnet. Sie ist Vorstandsmitglied der Interessensgemeinschaft der Literaturübersetzer/innen in Österreich und lebt in Wien.

Matej Povše
Miljana Cunta
Miljana Cunta ist eine slowenische Autorin, Redakteurin, Publizistin und Kulturmanagerin.

privat
Mascha Dabić
1981 in Sarajevo geboren, Studium der Translationswissenschaft (Englisch und Russisch), übersetzt Literatur aus dem Balkanraum. Sie lebt in Wien und setzte sich journalistisch mit dem Phänomen Migration auseinander (daStandard.at), arbeitet als Dolmetscherin im Asyl- und Konferenzbereich und lehrt an der Universität Wien. Ihr Debütroman Reibungsverluste landete auf der Shortlist Debüt des Österreichischen Buchpreises 2017; 2018 erhielt sie den Literatur-Förderungspreis der Stadt Wien.

Aleksandar Denić
Bojana Denić
Bojana Denić, geboren 1974 in Belgrad/Jugoslawien, studierte Germanistik an der Universität Belgrad. Bisher übersetzte sie mehr als fünfzig Titel der deutschsprachigen Literatur, unter anderem Werke von: Clemens Meyer, Wolfgang Hilbig, Anna Seghers, Uwe Johnson, Christa Wolf, Peter Handke, Elfriede Jelinek Thomas Bernhard, Wolfram Lotz und Heiner Müller. Manche der Bücher erschienen im von Bojana Denić 2017 gegründeten Kleinverlag Radni sto. Der Verlag orientiert sich an der ästhetischen Landschaft ‚Literatur ohne Land‘. Zurzeit arbeitet sie an Übersetzungen von Thomas Brasch und Brigitte Reimann.

Leonhard Pill
Marko Dinić
Geb. 1988 in Wien, ist ein serbischer Autor, der in Österreich lebt und in deutscher Sprache publiziert. Dinić wuchs in Belgrad auf, zog 2008 nach Österreich und studierte in Salzburg Germanistik und Jüdische Kulturgeschichte. 2012 veröffentlichte er Lyrik und Prosa erstmals in Anthologien und Zeitschriften. Er war Gast vieler Residence-Aufenthalte, u.a. in Brünn/CZ, Paliano/IT und Chretzturm/CH und Stadtschreiber in Pfaffenhofen an der Ilm/D, Schwaz/Tirol und Halle/D. 2012, sein erster Gedichtband Namen: Pfade: (Edition Tandem), 2019 erschien sein erster Roman „Die guten Tage“ (Zsolnay)

privat
Vedran Džihić
Vedran Džihić ist Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik (oiip), unterrichtet an der Universität Wien und an der Universität für Angewandte Kunst Wien. Er leitet das Center of Advanced Studies Southeastern Europe an der Universität Rijeka und ist Mitglied von „Balkans in Europe Policy Advisory Group“. Džihić ist Autor zahlreicher Bücher und Publikationen, ist aktiv in der Politikberatung und in öffentlichen Debatten. Er forscht zu Demokratieentwicklung, Nationalismus, Autoritarismus, Erweiterungs- und Außenpolitik der EU, Entwicklungen am Balkan und in Osteuropa, Protestbewegungen, Migration und Demokratie.

Elena Siretanu
Paula Erizanu
Paula Erizanu (1992) ist eine moldauische Journalistin und Schriftstellerin. Sie hat an der City University of London Journalismus studiert und lebt derzeit als freie Mitarbeiterin in Kischinew. Sie schreibt für die BBC, The Guardian, Financial Times und andere politische und literarische Zeitschriften in Rumänien und der Moldau. Sie hat auch Sachbücher und Literaturbücher geschrieben: „Aceasta este prima mea revoluție. Furați-mi-o!“ / „Dies ist meine erste Revolution. Steal it from me!“ (Cartier, 2011), „Ard pădurile“ / „Die Wälder brennen“ (Cartier, 2021).

Zuzana Finger
Zuzana Finger, geboren 1959 in Sala (Tschechoslowakei), studierte Slawistik und Balkanologie in Berlin. Seit 2010 ist sie Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 hielt sie zudem Vorlesungen im Fach Albanologie an der LMU München. Zuzana Finger übersetzt aus dem Albanischen, Serbischen, Slowakischen und Tschechischen ins Deutsche. Zu ihren Übersetzungen zählen unter anderem Werke von Eqrem Basha und Jeton Neziraj.

Marko Todorov
Will Firth
Will Firth wurde 1965 im australischen Newcastle geboren. Sein Schwerpunkt als literarischer Übersetzer liegt auf Prosa aus dem serbokroatischen Sprachraum sowie Nordmazedonien. Er studierte in Canberra Deutsch und Russisch, mit Serbokroatisch als Nebenfach. 1988–89 vertiefte er sich in die Südslawistik in Zagreb, verbrachte anschließend ein Postgraduiertenjahr in Moskau. Seit 1991 lebt er in Berlin und ist als freiberuflicher Übersetzer literarischer und geisteswissenschaftlicher Texte tätig. 2005–08 übersetzte er für das UNO-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien. Firth ist Mitglied der Übersetzerverbände VdÜ (Deutschland) und Translators Association (Großbritannien).

Maja Gebhardt
Maja Gebhardt wurde 1981 in Sarajevo geboren und kam wegen des Krieges in ihrem Heimatland 1992 als Geflüchtete nach Deutschland. 2005 schloss sie ihr Germanistik- und Anglistikstudium an der LMU München mit einem Magister Artium ab. Danach unterrichtete sie Deutsch als Fremdsprache in Integrationskursen und arbeitete als Prüferin im Sprachzentrum des Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch“, aber auch im Team der Balkantage, das sie bis heute durch Moderation des Folkloreprogramms und Organisation des Literaturtags unterstützt. Seit 2018 lebt sie in Berlin, wo sie inzwischen Buchpräsentationen für den eta-Verlag und Autor*innengespräche für den Buchclub BKS durchführt, wobei sie auch gerne aus den BKMS-Sprachen ins Deutsche dolmetscht und übersetzt.

Ognyan Georgiev
Ognyan Georgiev ist langjähriger Reporter und Redakteur der führenden bulgarischen Wirtschaftszeitung Capital. Derzeit leitet er Kapital Insights, das englischsprachige Büro, sowie die neue regionale Zweigstelle von Capital in Plovdiv, Bulgariens zweitgrößter Stadt. Georgiev ist Alumni der Robert Bosch Stiftung und des Fulbright-Programms. Außerdem verbrachte er ein Jahr am MIT, wo er zum Thema Stadtmigration forschte. Er ist Autor von “The Grand Return: COVID-19 and Reverse Migration to Bulgaria”, einem Bericht, der in Zusammenarbeit mit dem European Council of Foreign Relations erstellt wurde, sowie des Folgeberichts zum selben Thema über Bulgarien und Rumänien, publiziert in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission.

Rosie Goldsmith
Rosie Goldsmith ist eine preisgekrönte Journalistin für Kunst und Außenpolitik. Heute verbindet sie ihre journalistische Tätigkeit mit ihren Aktivitäten als Moderatorin und Kuratorin von literarischen Veranstaltungen und Festivals. Sie ist die Gründerin und Leiterin des European Literature Network und hat die Zeitschrift The Riveter ins Leben gerufen.

Svetla Stoyanova
Georgi Gospodinov
Georgi Gospodinov wurde 1968 in Jambol, Bulgarien, geboren. Einem großen internationalen Publikum wurde er mit seinem ersten Roman bekannt, dem Natürlichen Roman (1999) sowie dem Roman Physik der Schwermut (2014), die in mehr als zwanig Sprachen übersetzt wurden. Gospodinov wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. zweifach mit dem bulgarischen Buchpreis, dem Jan Michalski-Preis und dem Usedomer Literaturpreis. Im März 2022 erschien sein Roman Zeitzuflucht. Er lebt und arbeitet in Sofia.

Andrea Grill
Andrea Grill wurde in Bad Ischl geboren und studierte unter anderem in Salzburg. Sie promovierte an der Universität Amsterdam über die Evolution endemischer Schmetterlinge in Sardinien. Grill schreibt Lyrik, Erzählungen und Romane und übersetzt aus dem Albanischen und Niederländischen. Zu ihren Übersetzungen zählen u.a. der Roman Milchkuss von Mimoza Ahmeti, der Gedichtband Kinder der Natur von Luljeta Lleshanaku und Der Schlaf des Oktopus von Ervina Halili. Als Autorin veröffentlichte sie u.a. Das Paradies des Doktor Caspari (2015), Cherubino (2019) und zuletzt Bio-Diversi-Was? Reise in die fantastische Welt der Artenvielfalt und Seepferdchen, beide 2023 erschienen.

Radanko Vadanjel
Tatjana Gromača
Tatjana Gromača wurde 1971 in Sisak geboren und lebt in der Gegend von Zentralistrien und Pula. Sie studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie in Zagreb und schrieb jahrelang literarische Reportagen, Buchbesprechungen und Artikel zu kulturellen Themen für die inzwischen eingestellte, legendäre kroatische Wochenzeitung Feral Tribune. Seit 2008 ist sie Kulturkolumnistin und Reporterin für die Tageszeitung Novi list und freie Schriftstellerin (Lyrik, Prosa und Essays). Ihr Werk wurde zahlreich ausgezeichnet, u.a. mit einem Stipendium der Akademie der Künste Berlin.

Elisabeth Novy
Günter Kaindlstorfer
Günter Kaindlstorfer, geboren 1963 in Bad Ischl, ist ein österreichischer Literaturkritiker, Fernsehmoderator, Schriftsteller und Journalist.

Samira Kentrić
Samira Kentrić (1976) ist eine Künstlerin, die die soziale Realität um sich in Bilder verwandelt. Ihre Vorliebe ist es, surreale Situationen zu kreieren, um so die realste Realität hervorzuheben. Sie arbeitet in unterschiedlichen Techniken und wählt die, die am angemessensten ist. Ihr Augenmerk liegt auf der Schnittstelle zwischen öffentlicher und politischer Meinungsäußerung und dem intimen, privaten Alltagsleben der Menschen. Bis dato hat sie drei Graphic Novels veröffentlicht: Balkanalije (Autobiografie, 2015), Pismo Adni (über die Flüchtlingskrise, 2016) und Adna (2020).

Olja Knežević
Olja Knežević wurde in Podgorica, Montenegro geboren. 2008 schloss sie ihren M. A. in Kreativem Schreiben am Birkbeck College in London ab und erhielt den Overall Prize für die beste Abschlussarbeit, aus der später ihr erster Roman Milena & Other Social Reforms entstand. 2013 veröffentlichte sie einen Band mit autobiografischen Kurzgeschichten: London & Stories of the South. Es folgte ein weiterer Roman: Mrs. Black (2015, 2. Auflage 2021). Mit Katharina die Große und die Kleine (2019) liegt nun erstmals ein Buch von ihr in deutscher Übersetzung vor. Für das Manuskript erhielt sie den renommierten V.B.Z. Literaturpreis für den besten unveröffentlichten Roman in bosnischer/kroatischer/montenegrinischer/serbischer Sprache.

Robert Stürzl
Anne König
Anne König lebt als Verlegerin und Autorin in Leipzig. Mit Markus Dreßen und Jan Wenzel gründete sie 2001 den Verlag Spector Books. 2019 erschienen von ihr Bruchlinien. Drei Episoden zum NSU gemeinsam mit Nino Bulling sowie Jonas Mekas: I Seem to Live. The New York Diaries, 1950-2011 in zwei Bänden. Sie ist die Herausgeberin aller Bücher von Jonas Mekas im Programm von Spector Books und hat gerade eine Retrospektive zum 100. Geburtstag des Avantgarde-Filmemachers im Arsenal in Berlin co-kuratiert.

Mankica Kranjec
Jela Krečič
Jela Krečič, geboren 1979, ist eine slowenische Journalistin, Kolumnistin und Philosophin und mit dem bekannten Philosophen Slavoj Žižek verheiratet. Sie schreibt für die größte überregionale Tageszeitung »Delo«, in der sie 2013 ein Exklusivinterview mit Julian Assange veröffentlichte. Sie ist Mitherausgeberin mehrerer Sammelbände über zeitgenössische Fernsehserien und über den deutsch-amerikanischen Filmregisseur Ernst Lubitsch. Keine wie sie (Ni druge), ihr 2015 erschienenes literarisches Debüt, war in Slowenien sehr erfolgreich. 2018 erschien ihr zweiter Roman, Knjiga drugih (Das Buch der anderen).

Arian Leka
Arian Leka, geboren 1966, studierte Musik in seinem Geburtsort Durrës und Albanische Sprache und Literatur in Tirana. Er schreibt Gedichte, Erzählungen, Romane und Kinderliteratur und übersetzte unter anderem die italienischen Nobelpreisträger Eugenio Montale und Salvatore Quasimodo ins Albanische. 2004 gründete er das Internationale Poesie- und Literaturfestival POETEKA und ist seitdem Chefredakteur der gleichnamigen Literaturzeitschrift.

Marko Lipuš
Cvetka Lipuš
Cvetka Lipuš, geboren 1966 in Eisenkappel/Železna Kapla, studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Slawistik in Klagenfurt. Von 1990 bis 2000 war sie neben Maja Haderlap und Fabjan Hafner Mitherausgeberin der Kulturzeitschrift Mladje. Ab 1995 lebte und arbeitete sie in den Vereinigten Staaten, wo sie an der Universität Pittsburgh Bibliotheks- und Informationswissenschaften studierte. Sie schreibt in slowenischer Sprache und hat zahlreiche Gedichtbände veröffentlicht. Für ihre literarische Arbeit erhielt sie den Preis der Prešeren-Stiftung 2016, das Österreichische Staatsstipendium für Literatur und den Förderpreis des Landes Kärnten für Literatur.

Edi Matić
Tomislav Marković
Tomislav Marković, geboren 1976, lebt und arbeitet in Belgrad und ist Autor von Gedichten, Prosatexten und Essays. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Vreme smrti i razonode (Zeit des Todes und der Freude, 2009), der Gedichtband Čovek zeva posle rata (Der Mensch gähnt nach dem Krieg, 2014) und der satirische Prosaband Velika Srbija za male ljude (Großserbien für kleine Leute, 2018). Er schreibt Kolumnen für die Webportale Al Jazeera Balkans, Nomad.ba, AntenaM.net, Zurnal.info und Tacno.net. Einige seiner Texte liegen in albanischer, slowenischer, englischer, deutscher und ungarischer Übersetzung vor.

Una Rebic
Ana Marwan
1980 in Murska Sobota/SLO geboren, aufgewachsen in Ljubljana. Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft in Ljubljana und der Romanistik in Wien. Lebt als freie Autorin auf dem Land zwischen Wien und Bratislava und schreibt Kurzgeschichten, Romane und Gedichte auf Deutsch und Slowenisch. . „Der Kreis des Weberknechts“ (2019, 3. Aufl.) ist ihr Romandebüt. Ausgezeichnet mit dem exil-literaturpreis „schreiben zwischen den kulturen“ 2008, dem „Kritiško sito“ für das beste Buch des Jahres in Slowenien 2022 und dem Ingeborg Bachmann-Preis 2022.

Meikel Mathias
Meikel Mathias
Meikel Mathias, geboren 1985, aufgewachsen in Liechtenstein, lebt und arbeitet als diplomierter Designer, Illustrator und Comiczeichner in Berlin. Sein erstes Buch „Inshallah – Kurzgeschichten aus Marokko“ fundierte auf einer mehrmonatigen Recherchereise vor Ort und folgte dem Konzept der fiktionalisierten Alltagsreportage. Seine neuste Graphic Novel „ Straßen & Idioten“ bleibt diesem Arbeitsprinzip treu und versetzt den Leser nach Russland in das Jahr 2017, ein halbes Jahrzent vor den Angriffskrieg auf die Ukraine.

Catalina Flaminzeanu
Ioana Nicolaie
Ioana Nicolaie wurde 1974 in Sângeorz-Băi, im Norden Rumäniens geboren. Sie studierte Literatur an der Universität Bukarest. Anschließend arbeitete sie als Lehrerin, Jounalistin und für diverse Verlage. Heute lebt sie als freie Autorin in Bukarest.

Robertino Nikolic
Vivian Perkovic
Vivian Perkovic, geboren 1978 in Winterberg, ist eine deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin. Sie studierte Germanistik mit Schwerpunkt auf Medien und Theater und Südslawistik an der Universität Hamburg. Sie arbeitet derzeit für 3sat Kulturzeit.

Gezett
Jörg Plath
Jörg Plath, geboren 1960, ist Literaturredakteur von „Deutschlandfunk Kultur“ und schreibt für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sowie die „Neue Zürcher Zeitung“. Er war Lektor, Ghostwriter, Redakteur und Juror (Deutscher Buchpreis, Internationaler Literaturpreises). Gegenwärtig gehört er der Jury des Weltempfängers an.

Dora Held
Marko Pogačar
Marko Pogačar wurde 1984 in Split, Jugoslawien, geboren. Er hat einen MA in Literaturtheorie und Geschichte. Er hat fünfzehn Bücher mit Lyrik, Prosa und Essays veröffentlicht, für die er kroatische und internationale Auszeichnungen erhielt. Im Jahr 2014 gab er die Anthologie Junge kroatische Lyrik heraus, gefolgt von The Edge of a Page: Neue Lyrik in Kroatien (2019). Er war u.a. Stipendiat von Civitella Ranieri, Literarisches Colloquium Berlin, Récollets-Paris, Passa Porta, Milo Dor, Krokodil Beograd, Landis & Gyr Stiftung, Lyrik Kabinett München und DAAD Berliner Künstlerprogramm Stipendium. Seine Bücher und Texte sind in mehr als dreißig Sprachen erschienen.

Wolf-Dieter Grabner
Jelena Popržan
Jelena Popržan ist eine in Wien lebende Bratschistin, Sängerin, Komponistin und Performerin. Geboren 1981 in Novi Sad, Viola-Studium in Belgrad, Masterabschluss an der KUG/Oberschützen/Graz. 2008 gründet sie eigene Ensembles wie Catch-Pop String-Strong (u. a. Austrian World Music Award 2011), Sormeh und Madame Baheux (Austrian World Music Award 2014). Konzertreisen führten sie quer durch Europa, nach Peru, Mexiko, Kanada, Usbekistan, in die USA, die Türkei, alle Länder Ex-Jugoslawiens und alle Provinzen Österreichs. Ihr musikalisches Œuvre reicht von Klassik, World, Jazz, politisches Lied, Musikkabarett, Folk, Rock, Neue Musik, Stimmexperiment.

Janez Klenovšek
Uroš Prah
Uroš Prah, geboren 1988 in Maribor, veröffentlichte drei Gedichtbände: Čezse polzeči (2012), Tišima (2015 – nominiert für den Veronika Preis sowie den Simon Jenko Preis) und Udor (2019). 2018 erhielt er den Exil-Lyrikpreis für sein auf Deutsch verfasstes investigatives Gedicht Nostra Silva; zuletzt erschien in Literatur und Kritik die Kurzgeschichte Die Fächer. Übersetzungen seiner Bücher, Gedichte und Essays erschienen bisher in fünfzehn Ländern. Er war Mitbegründer und Chefredakteur der Literaturzeitschrift IDIOT, Programmdirektor des internationalen Festivals Literodrom und Mitbegründer des Museums des Wahnsinns, Trate. Uroš Prah lebt zur Zeit in Wien.

Lukas Beck
Doron Rabinovici
Doron Rabinovici, 1961 in Tel Aviv, lebt seit 1964 in Wien. Er ist Schriftsteller und Historiker. Sein Werk umfasst Kurzgeschichten, Romane, Essays und wissenschaftliche Studien. In Österreich bezieht er immer wieder prominent Position gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Rabinovici ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Für sein Werk wurde er u.a. mit dem Anton-Wildgans-Preis und dem Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet.

Dado Ljaljević
Jana Radičević
Jana Radičević, geboren 1997 in Podgorica, ist eine montenegrinische Autorin. Sie studierte Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Montenegro. Seit 2015 ist sie ein aktives Mitglied im Forum junger Schriftsteller:innen in Montenegro. Ihre Gedichtsammlung ako kažem može postati istina (wenn ich es sage, kann es wahrheit werden) wurde 2019 im serbischen Verlag Partizanska knjiga veröffentlicht. 2022 erschien im gleichen Verlag auch das Langgedicht zona neutralnog pritiska, das auf Deutsch unter dem Namen zone des neutralen druckes (Edition Thanhäuser, 2022) herausgegeben wurde. 2020/21 wurde sie als bisher jüngste Literatin Grazer Stadtschreiberin.

Dolia Rosa Imdorf
Nadya Radulova
Nadya Radulova, geboren 1975, ist eine bulgarische Dichterin, Übersetzerin und Lektorin. Sie studierte Linguistik und Gender Studies in Sofia und Budapest. Ihre Promotion im Fach mit dem Thema „Figuren der Weiblichkeit im literarischen Modernismus“ absolvierte sie an der Sofioter Universität. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet sowohl als Dichterin als auch als Übersetzerin aus dem Englischen.

Claudia Romeder
Claudia Romeder ist Leiterin des Residenz Verlags.

Maja Bosnić
Ivana Sajko
Ivana Sajko, geboren 1975 in Zagreb, ist Schriftstellerin, Theaterregisseurin und Performerin und arbeitet in den sich überschneidenden Bereichen Literatur, darstellende Kunst und Musik. Im thematischen Zentrum ihrer Texte stehen oftmals weibliche Perspektiven und die Auseinandersetzung mit der jüngsten osteuropäischen Geschichte. Zu ihren Büchern in deutscher Übersetzung gehören u.a. Rio bar (2008), Familienroman (2020), Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod (2022) und Liebesroman (2017), für den sie einen Internationale Literaturpreis des HKW erhielt. Sie lebt mit Sohn Yves und Hund Puntino in Berlin.

Mihai Neagu
Adrian Schiop
Adrian Schiop wurde 1973 in Porumbacu de Jos (Kreis Sibiu) geboren und studierte Psychologie, Erziehungswissenschaften und Linguistik in Cluj-Napoca. Nachdem er bereits mit seinen autofiktionalen Romanen »pe bune/pe invers« (2004) und »Zero grade Kelvin« (2009) auf sich aufmerksam machen konnte, gelang ihm im Jahr 2013 mit seinem dritten Roman »Soldații. Poveste din Ferentari« der endgültige literarische Durchbruch. Adrian Schiop ist freier Schriftsteller und Journalist und lebt in Bukarest. »Soldaten. Geschichte aus dem Ferentari« ist sein erster Roman in deutscher Übersetzung.

Jasper Kettner
Faruk Šehić
Faruk Šehić wurde 1970 in Bihać geboren. Bis zum Ausbruch des Krieges 1992 studierte Šehić Veterinärmedizin in Zagreb. Nach dem Krieg studierte er Literatur. Die Literaturkritiker sehen in ihm die Stimme der so genannten verstümmelten Generation. Sein Debütroman Knjiga o Uni (2011; Ü: Leise fließt die Una) wurde 2011 mit dem Meša Selimović-Preis für den besten in Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Kroatien erschienenen Roman und 2013 mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. In deutscher Übersetzung liegen der Gedichtband Abzeichen aus Fleisch (2011, Edition Korrespondezen) und die Kurzgeschichtensammlung Uhrwerkgeschichten (2021, Mimesis Verlag) vor.

Kushtrim Tërnava
Shpëtim Selmani
Shpëtim Selmani, geboren 1986, ist ein Schriftsteller und Schauspieler aus dem Kosovo. Zu seinen Büchern zählen Libërthi i dashurisë (Notizbuch der Liebe), das 2019 bei Armagedoni in Prishtina erschienen ist. Dafür ist er 2020 mit einem der Literaturpreise der Europäischen Union ausgezeichnet worden. Die deutsche Übersetzung erschien 2021.

Alexander Sitzmann
Alexander Sitzmann, geboren 1974 in Stuttgart, Studium der Skandinavistik und Slawistik in Wien, forscht und lehrt an der dortigen Universität; seit 1999 freiberuflich als literarischer Übersetzer aus dem Bulgarischen, Mazedonischen und den skandinavischen Sprachen tätig; Herausgeber mehrerer Anthologien, Sammelbände und Zeitschriftenschwerpunkte. 2004 Ehrenpreis des bulgarischen Kultusministeriums, 2016 Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung, 2020 Brücke Berlin Theaterpreis.

Dženat Dreković
Hana Stojić
Hana Stojić, geboren 1982 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, studierte an der Fakultät für Translationswissenschaft an der Universität Wien und arbeitet als Übersetzerin und Kulturmittlerin. Für ihre erste Übersetzungsarbeit ins Bosnische, Elfriede Jelineks Die Liebhaberinnen, wurde sie mit einer Übersetzungsprämie des österreichischen Bundeskanzleramts ausgezeichnet. Seit 2008 arbeitete sie für das Projekt Traduki, das sie von 2014 bis Ende 2021 leitete.

Christoph Thun-Hohenstein
Botschafter DDr. Christoph Thun-Hohenstein (geb. 1960) ist Leiter der Sektion für Internationale Kulturangelegenheiten im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich. Thun-Hohenstein studierte Rechtswissenschaften sowie Politikwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Für das Außenministerium hatte er Posten in Abidjan, Genf und Bonn inne. Von 1999 bis 2007 war er Direktor des Austrian Cultural Forum New York. Von 2007 bis 2011 war er Geschäftsführer von departure, der Kreativagentur der Stadt Wien. Von 2011 bis 2021 leitete Thun-Hohenstein das MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst als Generaldirektor und wissenschaftlicher Geschäftsführer. Er initiierte die Vienna Biennale for Change, die er von 2014 bis 2022 leitete. Zuletzt initiierte er die Wiener Klima Biennale, die erstmals von April bis Juli 2024 stattfinden wird.

Nini Tschavoll
Annemarie Türk
Annemarie Türk, geboren 1953 in Klagenfurt, studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Slowenische Sprache sowie kulturelles Management und Sponsoring. Von 1992 bis 2013 hatte sie die Bereichsleitung für Kulturförderung und Sponsoring bei KulturKontakt Austria inne und war für die kulturelle Zusammenarbeit mit und in 15 Ländern Ost- und Südosteuropas zuständig. Seit April 2013 ist sie selbstständig als Kuratorin und Lektorin für verschiedene Bildungseinrichtungen, kulturelle Institutionen und Universitäten tätig.

Žan Koprivnik
Anja Zag Golob
Anja Zag Golob, 1976 in Slovenj Gradec geboren. Sie ist Mitbegründerin und Herausgeberin des Verlags VigeVageKnjige und lebt als Autorin, Übersetzerin und Publizistin in Maribor. Auf Slowenisch liegen von ihr bisher vier Gedichtbände vor. In deutscher Übersetzung erschien zunächst der Auswahlband »ab und zu neigungen« (hochroth Wien, 2015) sowie das von Golob auf Deutsch geschriebene Hin-und-her-Gedicht mit Nikolai Vogel: »Taubentext, Vogeltext« (hochroth München, 2018). »Anweisungen zum Atmen« (2018) war ihre erste Buchveröffentlichung in der Edition Korrespondenzen.

Slavoj Žižek
Slavoj Žižek ist ein slowenischer Philosoph, Wissenschaftler am Institut für Philosophie der Universität Ljubljana und internationaler Direktor des Birkbeck Institute for the Humanities der Universität London. Er ist außerdem Professor für Philosophie und Psychoanalyse an der European Graduate School und Global Distinguished Professor für Germanistik an der New York University.